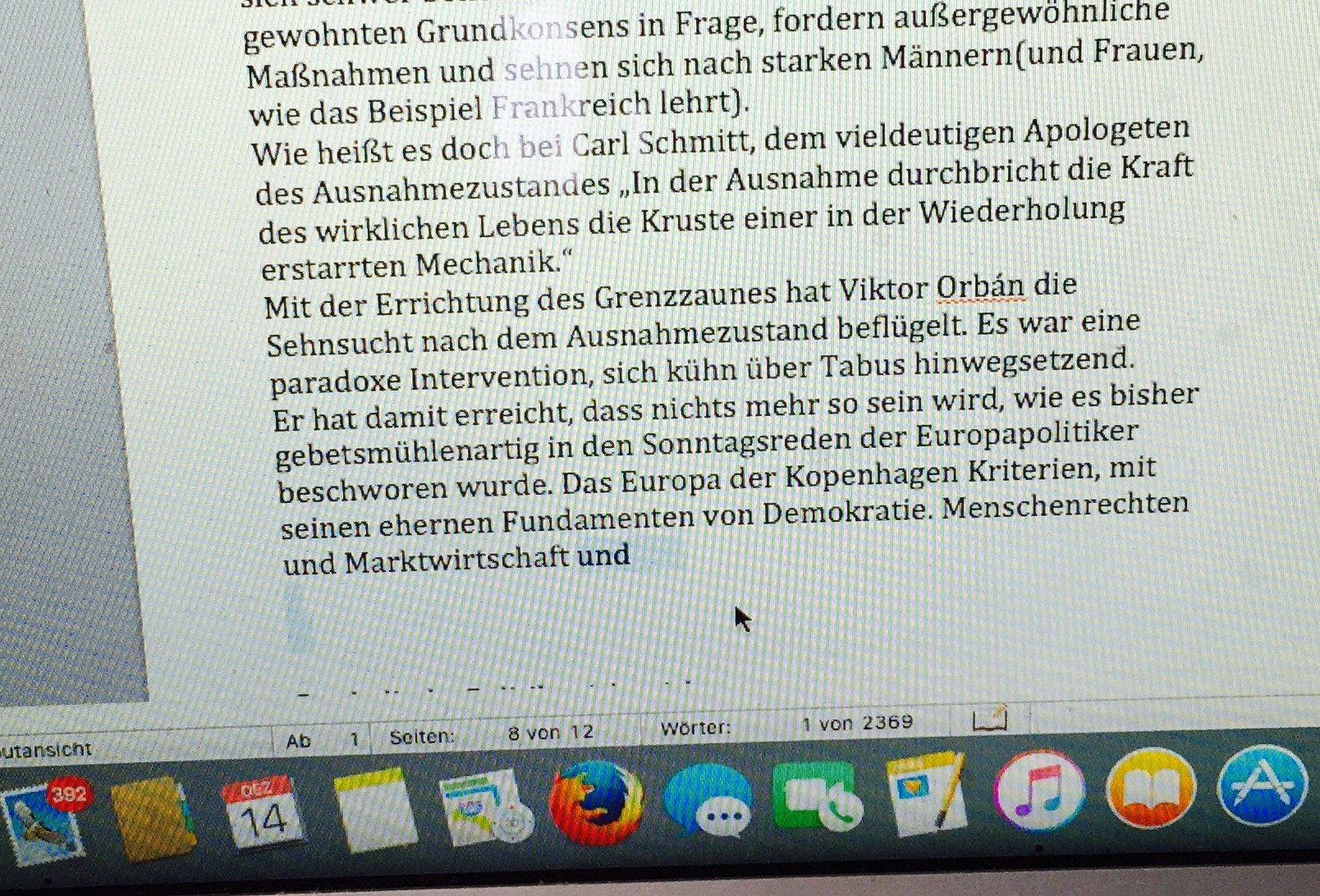„Wir haben euch nicht zugehört.“ Ein SPÖ-Politiker schreibt über den Niedergang seiner Partei und sagt, was Österreichs Sozialdemokratie jetzt ändern muss. Gastbeitrag von Josef Weidenholzer auf ZEIT online.
Als ich am Tag nach der Bundespräsidentenwahl zum Zug ging, wehte mir ein eisiger Wind entgegen. Und Schnee lag auf den Wiesen. Mitten im Frühling. So als wollte mir die Natur mit allem Nachdruck klarmachen, was mich die ganze Nacht schlecht schlafen ließ. Seit der Wahl ist es kalt geworden in Österreich. Sehr kalt. Das Land ist aus dem Modus der Berechenbarkeit gekippt. Völlig überraschend hat FPÖ-Kandidat Norbert Hofer, ein „Far Right Gun Enthusiast„ (wie ihn der konservative britische Telegraph bezeichnet), die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen. So klar, dass ein Sieg bei der Stichwahl am 22. Mai sehr wahrscheinlich ist.
Die „Basiswappler“
Die vom Wahlvolk gerade abgestraften Großparteien treffen Richtungsentscheidungen oder personelle Weichenstellungen traditionell in kleinen Zirkeln. Meist geht es um persönliche Befindlichkeiten und das immer wieder kurzfristig auszutarierende Machtgleichgewicht in Partei und Koalition. Längerfristiges steht kaum einmal zur Disposition. Irgendwann fällt das sorgsam austarierte Machtgefüge in sich zusammen, so wie bei den Politbüros im ehemaligen Ostblock. Implosion nennt man das. Einen solchen Moment erleben wir gerade. Auch in meiner Partei, der SPÖ.
Seit ich mich erinnern kann, werden von den eigentlich entscheidungsbefugten Gremien wie Parteivorstand oder Parteitag keine richtungsweisenden Beschlüsse gefasst. Es wird abgesegnet, was vorher in informellen Politbüros entschieden und über die Boulevardpresse bereits verlautbart worden ist. Und alle machen mit, um anschließend ihren Unmut hinter vorgehaltener Hand zu artikulieren, so wie beim letzten Richtungsschwenk in der Asylpolitik, einer 180-Grad-Volte.
Für alle, die die Sozialdemokratie schon im Reich der Toten wähnen, mag es paradox klingen, aber an der Basis der österreichischen Sozialdemokratie gibt es nach wie vor viele lösungsorientierte und diskursfähige Menschen, darunter auffallend viele junge Menschen und Frauen. Mehr jedenfalls als in anderen Parteien. Jede Firma würde ein solches Potenzial hegen. In der SPÖ aber tendiert man dazu, darin einen Störfaktor zu sehen. Wie abgehoben und zynisch muss man sein, wenn einem für diese Menschen bloß das böse Wort „Basiswappler“ einfällt. Wie groß muss die Geringschätzung dieses Potenzials sein, wenn man glaubt, bei der Erarbeitung eines neuen Parteiprogramms darauf verzichten zu können.
Facebook & Co. überlässt die SPÖ den Rechtspopulisten
Eine Partei, noch dazu eine sozialdemokratische, lebt vom freiwilligen Engagement und der Bereitschaft der Menschen, sich konstruktiv einzubringen. Diese Menschen sind ihr Kapital und nicht der fragwürdige Applaus durch auflagenstarke Zeitungen. Weil dieser erkauft und meist nicht einmal das viele Geld wert ist. Die Basis braucht kein Geld, sie will Respekt und Anerkennung. Sich auf Diskussionen, auch auf kontroverse einzulassen, ist ein Zeichen von Stärke. Dadurch entsteht Geschlossenheit. Freiwillig und nicht von oben erzwungen. Alle erfolgreichen sozialen Bewegungen funktionieren nach diesem Muster. Bruno Kreisky hatte diese Fähigkeit. Seine staatsmännische Leistung bestand darin, für Ideen und Projekte zu werben und die Menschen daran zu beteiligen. Man konnte ihm gleichsam beim Nachdenken folgen. Im Gegensatz zur Gründungszeit der Sozialdemokratie gibt es dank der Digitalisierung heute ungeahnte Möglichkeiten, Beteiligung und Meinungsaustausch zu organisieren. Doch Facebook & Co. hat die SPÖ verschlafen. Das überlässt sie lieber den Rechtspopulisten.
Wir haben uns auf die Meinungsforscher verlassen
Wir müssen mit den vom Rechtspopulismus Infizierten reden. Der größte Feind der Linken ist die weitverbreitete Selbstgerechtigkeit. Sie ist gefährlich, weil sie die anderen bloß in ihrer Abwehrhaltung bestärkt. Wir sollten uns endlich abgewöhnen, die Rechtschreib- und Grammatikfehler der Rechten wichtiger zu nehmen als die dahinterstehenden Inhalte. Ja, die Auseinandersetzung muss inhaltlich geführt werden. Seit längerer Zeit gibt es nur mehr einen Abtausch von Totschlagargumenten. Sicher stimmt, dass der Rechten jegliches Maß abhanden gekommen ist, dass sie die Wirklichkeit dramaturgisch verzerrt und offenen Hass propagiert. Übel kann einem dabei werden.
Gesprächsverweigerung ist aber keine Lösung. Es geht um das kritische Gespräch mit den Verführten, nicht ums Nachplappern. Wer glaubt, den rechten Verführern nacheifern zu müssen, gräbt ihnen nicht das Wasser ab. Vielmehr ermöglicht er diesen, den gesellschaftlichen Diskurs zu dominieren. Das Spielen mit Koalitionsoptionen („Warum nicht Rot-Blau„) macht lediglich die eigene Sprachlosigkeit sichtbar. Bevor man sich mit den Verführern ins Bett legt, sollte man sich um die Verführten Gedanken machen. Ein ehrlich gemeintes konstruktives Gespräch setzt die Bereitschaft zur Selbstkritik voraus. In Österreich ist diese wenig ausgeprägt. Vor allem in Momenten von Wahlniederlagen. Da wird Geschlossenheit angemahnt. Gerade jetzt aber warten die Wähler auf ein „Ja, wir haben eure Botschaft verstanden“. Etwa: „Wir haben euch nicht zugehört. Wir haben uns auf die Meinungsforscher verlassen. Obwohl wir es hätten wissen müssen, dass auf sie kein Verlass ist und dass sie nur Momentaufnahmen abbilden.“
Welche Demokratie wollen wir haben?
Die Wähler wollen, dass wir uns der Probleme annehmen, in aller Offenheit, Alternativen bedenken und nicht oberflächlich und symbolisch arbeiten. Sie wären erstaunt, zu hören: „Wir haben uns wichtiger genommen, als wir eigentlich sind. Uns ging es nicht um das Gesamtinteresse, um das Gemeinwohl. Wir wollten primär unsere Macht absichern, in Eisenstadt, in St. Pölten oder in Linz. Das Hemd liegt uns näher als der Rock. Daher war uns die Republik nicht so wichtig und schon gar nicht Europa.“ Diese Ehrlichkeit würden die Menschen schätzen und ihr Zorn wäre vielleicht nicht so gewaltig. Und wäre es nicht auch angebracht einzugestehen, dass man sich selber auf ein hohes Ross gehievt hat, mithilfe von Medien, die man dafür bezahlt hat. Deren Reaktion freilich nicht die erwartete Dankbarkeit war, sondern Hohn und Geringschätzung.
Unabhängige Medien sind die Voraussetzung für politische Erneuerung. Diese ist dringend notwendig. Wenn das die demokratischen Kräfte nicht machen, dann werden es andere tun, so wie das in Ungarn passiert ist. Das kann sehr schnell gehen. Es würde Österreich für Jahrzehnte von Kerneuropa entfernen. Österreich im Club der Illiberalen, das ist durchaus möglich. Im Club der Grenzzieher und Mauerbauer sind wir ja schon Mitglied, was vor einem Jahr auch niemand geglaubt hätte. Die Grundrechtscharta und die Menschenrechtskonvention stellen keinen Ballast dar, wie das in den letzten Monaten suggeriert wurde. Daher brauchen wir eine breite Diskussion über die Zukunft der Demokratie in unserem Land. Das neue Österreich muss ein unmissverständlicher Teil des europäischen Selbstverständnisses sein.
Page 4 of 14
Selten bin ich unter einer solchen Anspannung gestanden, wie in diesen ersten Wochen dieses Jahres. Alles ist in Bewegung geraten. Europas Bewährungsprobe steht bevor. Und ich bin froh, dass ich mich da einbringen kann. Ich weiß nicht, ob das je von Erfolg gekrönt sein wird, aber ich will es zumindest versucht haben. Meine Themen sind vielfältig und divergent, aus der Sicht Europas existenzielle Fragen: Flüchtlingskrise, Türkei, IS-Terrorismus, Kurdenfrage, Polen, Menschenrechte und Digitalisierung. Trotz dieser Anspannung will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen, was ich da vorvoriges Wochenende im Linzer Design Center erlebt hatte. Einen Parteitag meiner SPOÖ, der im Zeichen eines Neustarts stehen sollte und der beinahe ihr Ende bedeutet hätte.
Freitag, kurz vor Mitternacht hatte der zur Wiederwahl angetretene Parteivorsitzende Reinhold Entholzer erklärt nicht mehr zur Verfügung zu stehen und vorgeschlagen Johann Kalliauer zu seinem interimistischen Nachfolger zu bestimmen. Von niemandem erwartet, aber offensichtlich die einzige Möglichkeit Schlimmeres zu verhindern. Gegensätze, die schon lange die Landespartei paralysiert hatten, waren am Vortag des Parteitags aufgebrochen und erwiesen sich als unüberwindlich. Wilde Spekulationen wer, wann und warum, der bis dahin mühsam aufrechterhaltene Grundkonsens gesprengt war, machen seitdem die Runde. Es tut weh, so etwas mitzuerleben. Und es tut gut zu sehen, dass es den Delegierten beim Parteitag gelungen ist, nicht noch mehr Porzellan zu zerschlagen. So viel Selbstdisziplin habe ich selten erlebt. Es hätte viel schlimmer kommen können. Wir hätten uns ja auch zerfleischen können. Tröstlich vielleicht, aber auch nicht wirklich hilfreich.
Was ist mit OÖ los?
Zur Tagesordnung können wir keineswegs übergehen. Selbstdisziplin und die in diesen Tagen viel beschworene Geschlossenheit sind keineswegs Garanten dafür, dass das Comeback klappt. Es muss sich vieles ändern, will die SPOÖ wieder zur gestaltenden Kraft werden. Und die SPOÖ muss das wieder werden. Schnell. Weil Gefahr in Verzug ist. Oberösterreich, das Industriebundesland Nr. 1, Wachstumsmotor und Zukunftslabor der Republik wird gegenwärtig von einem schwarz-blauen Männerbund auf provinzielles Niveau zurückgestutzt und intellektuell ausgedünnt. Auf so einem Niveau kann keine Zukunft gedeihen. Wenn sogar schon der Schulhof zur politischen Kampfzone erklärt wird, wo soll da Weltoffenheit gedeihen. Die Exportregion Oberösterreich braucht ein Klima der Offenheit und der Toleranz, braucht weltoffene Menschen. Kleingeistigkeit und provinzielle Engstirnigkeit schnüren einer vom Export abhängigen Region die Luft ab und schädigen deren Zukunft. Es wird nicht einfach werden.
Den Industriestandort OÖ. zukunftsfest zu machen, ist die größte Herausforderung, weil das die Lebensgrundlage der Menschen sichert. Hier hat Schwarz-Blau nichts anzubieten. Partikularinteressen dominieren und oft fehlt es am intellektuellen Tiefgang und der sich daraus ergebenden Weitsicht. Oberflächlichkeit hat sich breitgemacht und alles, was an den Schutz von Arbeitnehmerrechten erinnert, wird verächtlich beiseitegeschoben. Die Sozialdemokratie wird als Verhinderertruppe dargestellt. Auch wenn es nicht stimmt.
Die SPOÖ hat in der Vergangenheit viel zur Attraktivität des Standortes beigetragen. Hat gegen die Skepsis der Konservativen mit großem finanziellem Aufwand die Sanierung der Verstaatlichten betrieben, gegen den anfänglichen Widerstand der ÖVP die Gründung der Standort- und Innovationsagentur des Landes TMG (jetzt ”Business Upper Austria”) durchgesetzt und durch eine umsichtige Politik die Sanierung des Standorts Steyr möglich gemacht. Und sie war auch ganz vorne mit dabei, dass aus einem dynamischen Industriestandort ein europaweit beachteter kultureller Hotspot wurde. An diese Tradition muss eine erneuerte Sozialdemokratie anknüpfen. Freilich mit neuen Methoden und neuen Modellen, ohne Denkverbote. Standortpolitik heißt vor allem, bestmögliche Lebensgrundlagen zu schaffen.
Back to Basics
Die nächsten Jahre werden uns vor riesige Herausforderungen stellen. Gerade für Industrieregionen wird es schwierig werden. Die zunehmende Robotisierung wird alles verändern. Sie wird viele Arbeitsplätze kosten, Abläufe und Lebensstile disruptiv verändern. Sicherheiten werden verloren gehen und Ängste allgegenwärtig sein. In einer solchen Situation suchen die Menschen Orientierung und Handlungsanleitungen. Dafür wäre eigentlich die Sozialdemokratie da, würde sie sich nur auf ihre Kernkompetenz besinnen. Das gesellschaftliche Ganze im Auge zu haben und für alle Menschen Perspektiven zu entwickeln. Nicht nur für die Besitzenden. Gerade in Zeiten epochaler Veränderungen braucht es soziale Absicherung in öffentlicher Verantwortung. Auch wenn die neuen Bedingungen die Sozialsysteme vor große Herausforderungen stellen, sie jetzt abzubauen wäre töricht und vor allem unmenschlich. Das würde den Weg in die Barbarei öffnen. Die Menschen erwarten mit Recht, nicht als Modernisierungsopfer zurückgelassen zu werden. Sie brauchen ein Sicherheitsnetz, auf das sie sich verlassen können.
Das ist die historische Aufgabe der Sozialdemokratie. Versagt sie in dieser Hinsicht, dann öffnet sie die Schleusen für die populistischen Zerstörer. Das erleben wir ja mittlerweile tagtäglich. Natürlich lassen sich diese Probleme nicht auf regionaler Ebene lösen. Aber es bedarf gerade des Anstoßes aus den Industrieregionen, damit sich auf nationaler und europäischer Ebene etwas bewegt. Viele Jahre hindurch war gerade die SPOÖ solch ein überregionaler Motor für Veränderungen. Auch wenn sie nicht die Macht hatte, Deutungshoheit hatte sie allemal. Diese wiederzuerlangen muss oberste Priorität haben. Dazu braucht es die Bereitschaft zu kritischer Auseinandersetzung. Allzu häufig hat sie aber in den letzten Jahren einfach nur den Kopf in den Sand gesteckt oder ist Problemen ausgewichen. Nur ja nicht Stellung beziehen, nur ja keine Ecken und Kanten zeigen. Und schuld waren meist die anderen. Und oft hat sie abgehoben und belehrend agiert.
Macht die Fenster auf
Das hängt unmittelbar mit ihrer starren Organisationsstruktur zusammen. Der damit verbundenen (Un)Kultur, personelle Weichenstellungen oder politische Richtungsentscheidungen top-down vorzunehmen. In Zeiten des Umbruchs kann man aber nur bestehen, wenn man offen und aufnahmebereit für Neues ist. Die Organisationsstruktur der Sozialdemokratie stammt aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Das Telefon war gerade erfunden, und wenn ein Auto durch ein Dorf fuhr, dann liefen die Leute zusammen. Ein Jahrhundert später kommunizieren die Menschen völlig anders, sind in Bewegung geraten und sind es gewohnt, individuelle Entscheidungen zu treffen. An den Strukturen ist das spurlos vorübergegangen. Seit Langem passiert das wirkliche Leben außerhalb der Parteistruktur. Man braucht sie lediglich, um bestimmte Machtpositionen zu erlangen oder abzusichern. Für die reale politische Auseinandersetzung ist sie meist hinderlich, weil sie unnötigerweise Kräfte bindet. Permanent mit sich selbst beschäftigt zu sein ist die beste Voraussetzung für Bedeutungslosigkeit.
Wenn man Politik nur durch den Filter der Partei wahrnimmt, dann läuft man Gefahr, den Anspruch der Gestaltungsfähigkeit zu verlieren. Politik reduziert sich dann auf die Fähigkeit, Koalitionen bilden zu können. Das Schielen auf Umfragen ersetzt den Diskurs mit den Mitgliedern und potenziellen WählerInnen. Politische Positionen müssen im Diskurs entstehen. Dazu brauchte es eine lebendige Diskussionskultur. Vertrauen, Respekt, Neugierde und auch ein gehöriges Quantum Demut. Vor allem aber Mut. Sich auf Diskussionen, auch auf kontroverse einzulassen, ist ein Zeichen von Stärke, weil Identifikation und Motivation gefördert werden. Dadurch entsteht auch eine neue, andere Form von Geschlossenheit. Freiwillig und nicht von oben erzwungen. Alle erfolgreichen sozialen Bewegungen funktionier(t)en nach diesem Muster. Im Gegensatz zur Gründungszeit der Sozialdemokratie gibt es dank der Digitalisierung heute ungeahnte Möglichkeiten, Beteiligung und Meinungsaustausch zu organisieren. Politisch zu führen, heißt in der Mitte dieses Prozesses zu stehen. Führen und nicht Hinterherlaufen.
Ein neuer Bezugsrahmen
Politik ist nur dann erfolgreich, wenn sie für die realen Probleme der Menschen – mögen sie noch so banal sein – Erklärungen und Lösungen anzubieten hat. Die Gemeinden und die Regionen (Bezirke) sind jene Ebenen, wo politisches Engagement ansetzen muss. Es sind diese scheinbar banalen Fragen, die Menschen dazu führen, sich in den politischen Prozess einzubringen. Nur Kurzsichtige und Verblendete sehen das nicht. Natürlich erwarten die Menschen von einer politischen Partei auch Antworten auf die globalen Probleme. Vor allem dann, wenn sie, wie bei der Flüchtlingskrise unmittelbar ihren Alltag betreffen. Aber es sind nur jene glaubwürdig, die in der Lage sind, auch die Probleme des Alltags zu lösen. Diese Fähigkeit war für Jahrzehnte die Basis für die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokratie. Will die SPOÖ wieder zur gestaltenden Kraft werden, dann muss sie sich auf die Arbeit in den Kommunen konzentrieren und den überschießenden Eifer der Landesbürokratie eindämmen. Der österreichische Föderalismus, der die Länder zum sinnstiftenden Fundament der Republik stilisiert hat, ist ein gewaltiges Hemmnis jeder vernünftigen Entwicklung. Er verengt den Blick und hat den lähmenden Stillstand unserer Republik mitbewirkt. Die gegenwärtigen Herausforderungen sind zu groß, als dass man sie einem „Landeshauptmann“ überlassen darf. Provinzielle Verengung, wie wir sie unentwegt erleben, zerstört unsere Zukunftschancen. Die oberösterreichische Sozialdemokratie muss zum Vorreiter eines neuen Regionalismus werden. Sein Bezugspunkt ist die lokale Ebene, aber sein Bezugsrahmen reicht weit über die historischen Landesgrenzen hinaus. Er ist national, grenzüberschreitend und europäisch. Es ist an der Zeit, den sich selbstermächtigenden Föderalismus zu entmachten.
Für eine Koalition der „Schwer Lenkbaren“
Das können nur Menschen tun, die „schwer lenkbar“ sind. Und davon es gibt es in Oberösterreich, der Heimat eines Stefan Fadinger und eines Richard Bernaschek viele. Gerade auch außerhalb des mit vielen Fördermitteln eingefriedeten Politgeheges. Die Menschen in Oberösterreich sind überdurchschnittlich an Politik interessiert. Zumindest habe ich diese persönliche Erfahrung gemacht. Viele von ihnen sind frustriert und marginalisiert. Sie gilt es zu gewinnen. Nicht um sie zu vereinnahmen. Nein, sie sollen zu Trägern der Erneuerung werden. Wir brauchen eine Koalition von aufrechten und unabhängigen Menschen, die positiv denken, die Zukunft, möge sie noch so bedrohlich erscheinen, als Chance begreifen und die niemand ausgrenzen wollen. Niemand soll ausgeschlossen sein. Wir brauchen viel mehr Frauen und junge Menschen in der Politik. Es darf keine Rolle spielen, ob jemand geistig oder manuell arbeitet, schon über Generationen in Oberösterreich beheimatet oder zugewandert ist. Und es ist gut, dass nicht alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher, wie das für mich zweifelsohne zutrifft, den Genuss von Schweinsbraten und Most zelebrieren. Die Vielfalt, ob im Religiösen oder im Lebensstil macht die Kraft einer Region aus. Einigkeit ist dort notwendig, wo es um die Grund- und Menschenrechte geht. Sie gelten für uns alle. Diese gemeinsamen Werte halten eine Gesellschaft zusammen und geben dem politischen Engagement erst einen Sinn. Wenn das Bekenntnis dazu fehlt, dann verkommt der politische Betrieb zu einem Selbstbedienungsladen.
Die Zukunft ist zu wichtig, als dass sie von der Optimierung von Einzelinteressen bestimmt werden darf. Die SPOÖ wird nur dann wieder aus dem Tal der Tränen herausfinden, wenn sie versucht, zum Katalysator einer Erneuerungsbewegung zu werden. Also sich nicht krampfhaft Koalitionspartnern andient, sondern die Koalition mit den Bürgerinnen und Bürgern sucht. Die Sehnsucht nach einer linken Alternative ist groß. Das sehen wir in diesen Tagen an den Erfolgen des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders und des britischen Labour-Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn. Ihnen gelingt es, durch konsequentes Ansprechen realer Probleme vor allem junge Menschen zum Mitmachen zu bewegen und die politischen Themen vorzugeben. Oberösterreich ist der Trendsetter für Österreich. Das war seit 1945 so. Wer hier gewinnt, gewinnt in ganz Österreich. Was sich hier durchsetzt, das hat Chancen in der gesamten Republik. Und was hier verloren geht, das geht auch woanders verloren. Das ist der Grund, warum mir in den letzten Wochen die Vorgänge in meiner oberösterreichischen Sozialdemokratie oft den Schlaf rauben.
Vor einem Jahr wusste kaum jemand etwas mit dem Begriff Balkanroute anzufangen. Und niemand hätte auch nur einen Cent darauf gewettet, dass damit eine ernsthafte Gefährdung des europäischen Projekts einhergehen könnte. Eurokrise, Griechenlandkrise oder die Situation im Osten der Ukraine. Alles Mögliche hatten diejenigen, die schon immer ein Zerfallen der Union vorhersehen wollten, bemüht. Aber die Flüchtlingskrise? Migration, Flucht und Vertreibung das waren Randthemen, die man am besten ignorierte. Weil man sonst Stellung hätte beziehen müssen.
Die fatalen Auswirkungen notorischer Ignoranz
Es galt die vermeintlich großen Dinge zu lösen: Stabilitätspakt, Wettbewerbsfähigkeit etc. Viel zu lange wurde das Thema Migration und Flucht vernachlässigt und die Reform des Dublin-Systems, von dem niemand jemals wirklich überzeugt war, auf die lange Bank geschoben. Nur nichts Neues wagen und einfach weitermachen, als ob es keine Probleme gäbe. Augen zu. Dabei wäre die Sache im Prinzip recht einfach zu lösen gewesen. Im europäischen Zusammenwirken allerdings. Weil aber in Migrationsfragen zumeist das Kalkül nationaler Innenpolitik den Takt bestimmt, staute sich eine explosive Gemengelage auf. In der Flüchtlingskrise bündelt sich das Versagen der europäischen Politik. Einer Politik, die von kurzfristigen Überlegungen getrieben und von Einzel-und Partikularinteressen dominiert ist. Kleinkariertheit, Engstirnigkeit und provinzielle Kirchturmpolitik sind die besten Voraussetzungen für kolossales Scheitern.
Eine differenzierte Sicht der Entwicklungen ist notwendig
Hätte man zeitgerecht und adäquat reagiert, wäre es niemals zu dieser Flüchtlingskrise gekommen. Sie ist das Resultat eines grundlegenden Politikversagens, in den Nationalstaaten und auf europäischer Ebene. Eigentlich haben wir es ja mit unterschiedlichen Phänomenen zu tun. Es geht um Migration, Flucht und Vertreibung und politische Verfolgung. Unterschiedliche Phänomene, denen unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen und die von der Politik daher auch unterschiedlich beantwortet werden müssen. Migration ist nichts Neues. Seit es Menschen gibt, wandern sie: ein und aus. Relativ neu ist, dass Europa zu einem Einwanderungsziel wurde. Vor einer Generation war das noch umgekehrt. Das spricht zunächst einmal für die Attraktivität des europäischen Modells. Migration wird von Push- und Pull-Faktoren bestimmt. Im Idealfall bedingen sie sich wechselseitig.
Es gibt viele Gründe, warum Staaten Zuwanderung positiv sehen sollten. Erfolgreiche Nationen tun dies auch. Zumeist sind das wirtschaftliche Gründe. Im Fall Europas auch demografische. Das ist historisch betrachtet tatsächlich neu. Es gibt aber nicht nur erwünschte Migration. Oft ist sie erzwungen. Menschen müssen aus wirtschaftlichen Gründen (bald wahrscheinlich auch wegen der Klimaerwärmung) ihre Heimat verlassen. Gerade im Falle Afrikas sind diese Pushfaktoren wirksam und zumeist Resultat verantwortungsloser Politik: Nicht nur lokalen Faktoren, sondern vor allem unserer Handelspolitik und einer ungenügenden Entwicklungspolitik geschuldet. Wirtschaftsflüchtlinge, um eines der Unwörter dieses Unglücksherbstes zu verwenden, kann man deshalb nicht als isoliertes Phänomen betrachten. Seit Langem gibt es diesen Migrationsdruck in Richtung Europa. Lange glaubte man, dem durch Abschottung begegnen zu können. Festung Europa nannte sich dieses vergebliche Bemühen.
Das unselige Dublin-Regime
Die einzige Möglichkeit legaler Zuwanderung blieb somit das Asylverfahren. Entstanden aus den Erfahrungen mit Krieg und Faschismus sollte es politisch Verfolgten Schutz und Asyl bieten. Indem sich Europa zu keiner einheitlichen Migrationspolitik durchringen konnte, wurde das Asylverfahren zum einzigen Ventil für Zuwanderung. Dafür war es allerdings niemals gedacht, was auch den Handelnden immer klar war. Zu einer europäischen Asylpolitik konnte man sich aber nie durchringen. Das Dublin-Regime, wonach der jeweilige Ersteintritt in den Schengen-Raum entscheidend ist, verschob das Problem an die Peripherie Europas. Es funktionierte nie wirklich. Und der Norden, vor allem das vor ökonomischer Kraft strotzende Deutschland, scherte sich wenig um die Anrainerstaaten am Mittelmeer, die in immer stärkerem Ausmaß mit Massenzuwanderung konfrontiert waren. Wichtig war bloß die Einhaltung der ökonomischen Stabilitätskriterien und dass diese die deutsche „Primärtugend“ der Haushaltsdisziplin hochhielten. Freilich gab es einige erfolgversprechende Ansätze wie die Harmonisierung der Asylstandards durch das „European Asylum Support Office“ (EASO) oder die Verabschiedung des Asylpakets von 2013, das einheitliche Aufnahme- und Versorgungsstandards, allerdings auf niedrigem Niveau, festlegte. Diese europäischen Versuche kamen – wie sooft- zu spät, sie waren halbherzig und wurden nur ansatzweise umgesetzt.
Hätte man doch zeitgerecht (re)agiert
Es fehlte nicht an Stimmen, die vor einem Scheitern Dublins warnten. Doch niemand scherte sich darum. Die niemals verstummenden Stimmen aus der Zivilgesellschaft wurden als lästige Zurufe abqualifiziert. Man hätte auch auf die Mahner im Europäischen Parlament hören können. In so gut wie jeder einschlägigen Debatte konnte man die Zweifel an Dublin vernehmen. Die Regierenden hätten ernst nehmen müssen, was im Parlament debattiert wird. Zumindest die Rechtsprechung der europäischen Gerichte hätte sie überzeugen müssen, dass Dublin nicht funktioniert. Schon 2011 hatte der EMRG geurteilt, dass nicht mehr nach Griechenland abgeschoben werden dürfe. Die Bedingungen waren katastrophal. 2013 beherbergte das Land über 1,3 Mio. Menschen mit irregulärem Aufenthaltsstatus. Dieses Land war schon vor der Fluchtbewegung des Sommers 2015 völlig überfordert. Wieso sollte es ausgerechnet diese Belastungen meistern können? Griechenland war kaputtgespart und gedemütigt. Martin Schulz meinte unlängst zu Recht: „Jetzt kriegen wir die Quittung für dieses Verhalten.“
In der Tat hat kurzsichtiges Handeln oft weitreichende Folgen. Schäbige Knausrigkeit war es, die den größten Flüchtlingsstrom seit dem Zweiten Weltkrieg in Gang setzte. Ein auslösendes Moment des großen Flüchtlingstrecks war, dass sich die visionäre Energie der europäischen Staatskanzleien darauf reduzierte, Einsparungen durchzusetzen. Dort wo es das Wahlvolk nicht unmittelbar spürt. Wie etwa bei der Finanzierung internationaler Hilfsprogramme. Bis zum Jahresbeginn 2015 konnten die Menschen in den Flüchtlingslagern rund um Syrien mit 29 Dollar pro Monat und Person rechnen. Ab Frühsommer war es weniger als die Hälfte. Wer nicht in der Lage ist, daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, ist von politischer Torheit gezeichnet. Angela Merkel gestand den Fehler wenigstens ein: „Wir haben alle….ich schließe mich da ein, nicht gesehen, dass die internationalen Programme nicht ausreichend finanziert sind, dass Menschen hungern in den Flüchtlingslagern, dass die Lebensmittelrationen gekürzt wurden.“ Sie machte diese Aussage anlässlich des EU-Flüchtlingsgipfels am 25.9. der, bei dem eine Milliarde Euro Unterstützung für Syrienflüchtlinge vereinbart wurde.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben
Der Flüchtlingstreck setzte ein, weil die Menschen keine Lebensgrundlage mehr hatten und weil sie keine Möglichkeiten mehr sahen, in der Umgebung Syriens auszuharren. Mehr als vier Jahre lang waren mehr als vier Millionen Menschen in der Nähe ihrer Heimat geblieben, in der Hoffnung jederzeit zurückkehren zu können. Eine energischere, europäische Außenpolitik – unter Einbeziehung des Irans und Russlands – hätte Bedingungen schaffen können, wo diese Perspektive offen geblieben wäre. Wenn auch kein sofortiger Friedensschluss, aber zumindest ausverhandelte Sicherheitszonen wären im Bereich des Möglichen gewesen. Aber auch dazu war man nicht in der Lage. Bis heute ist das Mandat der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini,was Syrien betrifft, äußerst vage, weil die Mitgliedstaaten eben nationale Alleingänge bevorzugen. Auch das Fortbestehen des Syrienkonflikts ist auf die Kurzsichtigkeit der Handelnden zurückzuführen. Dieser geht nunmehr in sein fünftes Jahr. Europa tut aber so, als ob es sich um etwas Kurzfristiges handeln würde und man jederzeit zum Status quo ante zurückkehren könnte. Schon im Frühstadium hätte man Maßnahmen ergreifen müssen, um den Menschen in und um Syrien gemeinsam mit dem UNHCR die legale Ausreise in die EU und andere aufnahmebereite Staaten zu ermöglichen.
So wie bei früheren Konflikten in Bosnien oder im Kosovo hätten man bestimmte Quoten für Kontingentflüchtlinge vereinbaren müssen. Ich habe 2013, zu einem Zeitpunkt, wo sich gerade einmal 1000 Syrienflüchtlinge in Österreich befanden, gefordert die im Zuge der Balkankriege entstandene Massenzustromrichtlinie als Rechtsrahmen für ein europäisches Resettlementprogramm auf der Basis von Quoten für die einzelnen Mitgliedstaaten zu reaktivieren. Außer ein paar Dutzend „likes“ auf Facebook gab es keine Reaktionen, obwohl ich mich intensiv um Resonanz bemühte. Mit einem derartigen Instrument wäre es wohl niemals zum großen Flüchtlingstreck dieses Sommers gekommen. Mit all seinen negativen Nebeneffekten, wie dem Verlust politischer Steuerung oder dem Einfluss von organisiertem Schleppertum. Europa hätte vor allem Handlungskompetenz bewiesen und wäre von den Menschen als politischer Faktor wahrgenommen worden und nicht als hilfloser Papiertiger.
Die Stunde der Angstmacher und Glücksritter
Wer nicht handelt, überlässt das Feld anderen. Die ab Juli massiv zunehmende Flüchtlingsbewegung auf der Balkanroute, für die man keinerlei Vorbereitungen getroffen hatte, war die perfekte Gelegenheit für nationalistische Politiker, sich in Szene zu setzen. Nicht um das Problem zu lösen, sondern um es vom jeweiligen Land fernzuhalten. Vor allem aber, um in der Rolle des starken Mannes auch von eigenen Problemen abzulenken. Der Sommer 2015 war die Stunde der Glücksritter und Angstmacher. Innerhalb weniger Wochen fielen alle Hemmungen. Hetzerische Lügen wurden in Umlauf gesetzt und die Opfer zu Tätern gemacht. Und es gehörte mitunter nicht nur Energie, sondern auch Mut dazu, den Flüchtlingen zu helfen. Man machte sich lustig über die Willkommenskultur und unterstellte, dass diese den Massenexodus aus dem Nahen Osten verursacht hätte.
Viktor Orbán war der Erste. Noch Anfang des Jahres 2015 schien er politisch angezählt. Seine politischen Freunde in Ungarn begannen sich abzuwenden und es schien nur mehr eine Frage der Zeit zu sein, ob er im Sumpf der von ihm verursachten Korruption untergehen würde. Ich erinnere mich an Gespräche mit orbánkritischen Freunden in der EVP, die mir ihre Schadenfreude darüber anvertrauten. Doch Orbán ist immer dann stark, wenn er in Bedrängnis gerät. Wie immer setzte er auf die nationalistische Karte, diesmal nicht gegen die slowakischen oder rumänischen Nachbarn, sondern gegen die Ausländer ganz allgemein. Er mimte den harten Mann, der sein Land gegen die Invasion der Fremden verteidigen würde und der auch nicht vor der Wiedereinführung der Todesstrafe zurückscheue. Mit einer manipulativen Befragung heizte er die Stimmung auf. Zu diesem Spiel gehörte auch ein Auftritt im Europäischen Parlament. Er kam nicht, um mit uns zu diskutieren. Straßburg diente ihm als Bühne für zu Hause. Ich habe ihm dies in meinem Redebeitrag auch vorgeworfen. Sein Auftritt sorgte für Kopfschütteln, weit in das rechte Spektrum hinein. Das war ihm egal, vielleicht war es sogar beabsichtigt. Orbán war ja nach Straßburg gekommen, um die Ohnmächtigkeit der EU zu demonstrieren.
Das „liberale Blabla“ der EU-Eliten wäre eben nicht geeignet, die Invasion Ungarns zu verhindern. Da müsse Ungarn zur Selbsthilfe greifen. Großflächenplakate – sinnvollerweise in ungarischer Sprache – forderten in weiterer Folge die Migranten auf, nicht in Ungarn zu bleiben und schließlich wurde mit dem Bau eines Zauns zu Serbien begonnen. Dann kamen die chaotischen Szenen vom Budapester Keleti Bahnhof. Die Situation geriet aus den Fugen. Und es wäre noch schlimmer gekommen, wenn Merkel und Faymann nicht die Notbremse gezogen hätten. Orbán wollte sich als Retter Ungarns, als Verteidiger des Abendlandes inszenieren: Orbán als Mann der Tat, der die liberalen Weicheier in Brüssel vor sich hertreibt. Das Spiel ist aufgegangen. Und wieder zeigt sich, wohin politische Kurzsichtigkeit führt. Wie oft haben wir im EP Orbáns Verhalten kritisiert und es dann bei Abmahnungen belassen, weitere Schritte angekündigt oder auf dies oder jenes gewartet. Geschehen ist niemals wirklich etwas. Gegen den Zaunbau gab es nur verhaltene Kritik der Kommission, ja Ungarn erhielt zu diesem Zeitpunkt sogar finanzielle Unterstützung für die Bewältigung der Flüchtlingsprobleme.
Der ersehnte Ausnahmezustand
Der September 2015 markiert eine Zäsur, die man im Abstand einiger Jahre noch deutlicher erkennen wird. Nicht nur, dass sich zu dem seit dem Ausbruch der Finanzmarktkrise virulenten Nord-Süd Konflikt nun mehr ein West-Ost Konflikt gesellt und damit die zentrifugalen Kräfte stärkt. Dieser Konflikt ist viel tief greifender. In den lähmenden Auseinandersetzungen mit Griechenland ging es vor allem um ordnungspolitische Fragen. Nunmehr wird zum ersten Mal der Wertekonsens der Union in Frage gestellt. Gemeinsame, mit Mehrheit gefasste Beschlüsse, wie die Flüchtlingsquote werden ignoriert und gemeinsame Regeln, etwa was Schengen und Dublin betrifft, einfach nicht eingehalten. So etwas gab es zwar auch schon früher, aber nicht in diesem konzertierten Ausmaß. Vor allem aber gab es Sanktionen der europäischen Ebene gegen solche nationalen Alleingänge. Mittlerweile ist es schwierig geworden, auch nur Ansätze dazu zu erkennen.
Europa wird als inkonsequent und hilflos erlebt. Es hat sich ein Gefühl breitgemacht, dass alles außer Kontrolle ist. In einem derartigen Klima gedeihen Wut und Angst. Beides Gefühle, die sich schwer beherrschen lassen. Viele stellen plötzlich den gewohnten Grundkonsens in Frage, fordern außergewöhnliche Maßnahmen und sehnen sich nach starken Männern (und Frauen, wie das Beispiel Frankreich lehrt). Wie heißt es doch bei Carl Schmitt, dem vieldeutigen Apologeten des Ausnahmezustandes: „In der Ausnahme durchbricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in der Wiederholung erstarrten Mechanik.“ Mit der Errichtung des Grenzzaunes hat Viktor Orbán die Sehnsucht nach dem Ausnahmezustand beflügelt. Es war eine paradoxe Intervention, sich kühn über Tabus hinwegsetzend. Er hat damit erreicht, dass nichts mehr so sein wird, wie es bisher gebetsmühlenartig in den Sonntagsreden der Europapolitiker beschworen wurde. Das Europa der Kopenhagen-Kriterien, mit seinen ehernen Fundamenten von Demokratie. Menschenrechten und Marktwirtschaft ist gehörig ins Wanken geraten. Orbán wird dafür bewundert. Das Spektrum reicht von Strache, le Pen bis zu Seehofer und Teilen der ÖVP. Und er wird kopiert, in der Slowakei oder in Polen. Niemand weiß, wer als Nächster folgt.
Alles in allem eine hochexplosive Situation. Das Lager der Nationalisten wächst. Neuerdings nennen sie sich, ausgehend von Frankreich, Souveränalisten. Ganz im Sinne Schmitts, wonach jener, „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.“ Und es erinnert fatal an Orbáns „Illiberalismus“: „Wer Menschheit sagt, der will betrügen………Soziale Ordnung braucht verortbare und verteidigbare Grenzen.“ Diese Entwicklungen sind gefährlich, sehr gefährlich. Es ist höchste Zeit, mit der kurzsichtigen und inkonsequenten Politik aufzuhören, Probleme nicht bloß mit symbolischen Handlungen zu begegnen. Wie gerade jetzt wieder bei der Terrorismusbekämpfung. Wir müssen europäische Gestaltungshoheit zurückgewinnen. Vor allem dürfen wir uns nicht weiter von den politischen Glücksrittern hertreiben lassen. Die Flüchtlings- und Migrationsfrage ist der Prüfstein des europäischen Projekts. Wir werden nur dann Erfolg haben, wenn wir eine kohärente Politik, die den differenzierten Herausforderungen gerecht wird, umsetzen können. 2016 wird daher ein entscheidendes Jahr, vielleicht das wichtigste seit der Gründung der Union. Wie eine konsequente und kohärente Flüchtlings-und Migrationspolitik aussehen soll, darüber mehr in meinem nächsten Blog.
Mehr als 100 Jahre sind vergangen, dass Österreich in der heute gültigen Form existiert: als parlamentarische Demokratie und europäischer Kleinstaat. Am 12. November 1918 wurde die Republik Deutsch -Österreich ausgerufen. Damit endete die jahrhundertealte Herrschaft der Habsburger Dynastie. Erstmals ging die “Macht vom Volk” aus. Für die Sozialdemokratie war dies der ersehnte Neubeginn, für manche freilich nur ein unabdingbarer Zwischenschritt zu einer besseren und gerechteren Zukunft.
Für den Großteil des bürgerlichen Lagers, wie es sich seit diesem Zeitpunkt zu nennen pflegt, jedoch nur das kleinere Übel angesichts einer drohenden, von Russland ausgehenden Weltrevolution. Der jungen Republik haftete in diesen Kreisen der Geschmack des Ungewollten, des Zufälligen an. Vor allem kränkte es das angeschlagene Selbstbewusstsein, ein bloßes Überbleibsel zu sein, etwas was Clemenceau zynisch auf den Punkt gebracht hatte: Autriche, c´est ce qui reste.
Statt sich in der Realität einzurichten, gefiel man sich darin, von einer Wiederkehr der Bedeutung des Habsburgerreiches in Gestalt einer Donauföderation der Nachfolgestaaten zu träumen, in der ein katholisches Österreich die führende Rolle spielen sollte. Die großdeutsche Option verfolgte man auf christlicher Seite eher halbherzig, weil auch das Deutsche Reich den Makel aufwies, eine demokratische Republik zu sein.
Der Realität einer parlamentarischen Demokratie war aber vorerst nicht zu entkommen, ja man musste mit ihr auskommen. Sicherte sie doch Machterhalt und Zugang zu Ressourcen. Sich damit mit ihr zu arrangieren bedeutete jedoch nicht, sie auch wertzuschätzen. Dies erklärt auch, warum der 12.November, der seit 1919 ebenso wie der 1.Mai als „allgemeiner Ruhe–und Festtag“ begangen wurde, bei den Christlichsozialen nie sonderliche Popularität erlangen konnte. Man zog es vor, den in zeitlichem Zusammenhang stehenden Leopolditag (15.November) für eine Männerwahlfahrt nach Mariazell zu nutzen. Der 12.November war ein wichtiger Tag für die österreichische Sozialdemokratie ähnlich dem 1.Mai.
Das Republikdenkmal neben dem Parlament – zehn Jahre nach Ausrufung der parlamentarischen Demokratie eingeweiht- sollte diese Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Es wurde zum Symbol der Auseinandersetzungen der Ersten Republik, am 12.November 1932 zunächst Schauplatz gewalttätiger Konflikte, dann 1933 zugehängt und somit dem Publikum entzogen, 1934 schließlich abgetragen. Als die Demokratie, bzw. das, was nach der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 von ihr übriggeblieben war, schließlich im Februar 1934 unterging da waren die Fronten klar: Auf der einen Seite die sozialdemokratische Linke, die bereit war, die Verfassung auch mit dem äußersten Mittel des bewaffneten Kampfes zu verteidigen, auf der anderen Seite das zersplitterte konservative Lager, das die demokratische Verfassung opferte, um den aufstrebenden Nazis das Ruder aus der Hand zu reißen. Der 12.November würde sich dazu eignen, diese Fragen zu thematisieren: Was unsere Verfassung ausmacht, warum sie im entscheidenden Augenblick nicht funktioniert hat und welche Reformperspektiven es gibt. Die Erste Republik war als parlamentarische Demokratie konzipiert; ihr Machtzentrum war das Parlament, der Nationalrat, der die Regierung wählte. Als „Hüter der Verfassung“ fungierte der Verfassungsgerichtshof, dessen Mitglieder ebenfalls vom Nationalrat, und zwar auf Lebenszeit, gewählt wurden. Die Einführung dieser Institution geht auf Hans Kelsen zurück, der auch wesentlich an der Ausarbeitung des BVG von 1920 beteiligt war.
Der Nationalrat war also die einzige Staatsgewalt, die durch direkte Volkswahl legitimiert war. Die zweite Kammer des Parlaments, der Bundesrat, wurde auf Drängen der Bürgerlichen installiert – vor allem die Christlichsozialen definierten sich über die Selbstständigkeit bzw. Autonomie der historischen österreichischen Länder und forderten massiv eine zweite parlamentarische Kammer. Obwohl die Kleinheit des neuen Staates eine Zentralisierung der politischen Macht vernünftig erscheinen ließ, wurde diese von den Christlichsozialen massiv abgelehnt und die speziellen Interessen der Länder dem „Wiener Zentralismus“ gegenüber gestellt. So gewannen die oberösterreichischen Christlichsozialen die ersten Landtagswahlen 1919 mit dem Slogan „Oberösterreich den Oberösterreichern !“ Grundsätzlich kommt das Konzept des Parlamentarismus ohne ein Staatsoberhaupt aus. Ursprünglich war diese Funktion auch nicht vorgesehen.
Auf Druck des bürgerlichen Lagers wurde die Position des Bundespräsidenten geschaffen, der allerdings von der Bundesversammlung gewählt wurde und rein repräsentative Aufgaben hatte. In einer anderen Frage hatten sich die Sozialdemokraten durchgesetzt: im B.-VG von 1920 sind direktdemokratische Instrumente nur sehr schwach vertreten. Eine Volksabstimmung ist nur in jenen (Einzel)Fällen vorgesehen, in denen der Nationalrat durch Beschluss die Gesetzgebungskompetenz an das Volk überträgt, sowie bei einer Gesamtänderung der Verfassung. Diese Zurückhaltung war durch die historische Erfahrung des Bonapartismus begründet: Napoleon I. wie auch Napoeon III. hatten das Referendum dazu benutzt, um ihre eigene Machtergreifung durch das Volk absegnen zu lassen. Allerdings begann das bürgerliche Lager schon früh das politische System der Republik in Richtung eines Präsidialsystems zu verändern. Vorbild war die Weimarer Reichsverfassung mit ihrer starken Stellung des Reichspräsidenten. 1928 begannen in Österreich die Verhandlungen um eine Verfassungsreform, die mit der B.-VG – Novelle von 1929 abgeschlossen wurden. Nun gab es auch in Österreich einen „starken“ Bundespräsidenten; durch direkte Volkswahl bestimmt, besitzt er die gleiche Legitimation wie das Parlament.
Er ernennt und entlässt die Regierung, kann den Nationalrat auflösen, besitzt ein Notverordnungsrecht und ist Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Die Sozialdemokratie leistete hinhaltenden Widerstand und erreichte einige kleinere Abschwächungen der Novelle, im Kern hatte sich jedoch das konservative Lager durchgesetzt. Den wenigsten ist heute bewusst, dass unsere heutige Verfassung in eben dieser Fassung von 1929 existiert. Dies war bei der Wiederbegründung der Republik 1945 keineswegs die selbstverständlichste Option. Die beiden die Regierungsverantwortung tragenden Parteien wollten die Auseinandersetzungen der Ersten Republik nicht fortsetzen und einigten sich darauf, die Gräben nicht mehr aufzureißen. Harmonie anstatt Auseinandersetzung, das war vielleicht eine erfolgreiche Überlebensstrategie angesichts einer bedrohenden Präsenz der Besatzungsmächte, sie bedeutete langfristig allerdings auch eine Lähmung der politischen Diskussionskultur. Der 12. November, als Staatsfeiertag hatte unter diesen Umständen auch keine Notwendigkeit mehr. Die Begründung dafür, warum man ihn nicht mehr wiederaufleben ließ war typisch österreichisch, typisch für die Oberflächlichkeit mit der fortan demokratiepolitischen Fragen auswich.
Karl Renner erklärte lapidar, dass das kalte Wetter rund um diesen Tag dies nicht als ratsam erscheinen ließe. Dies hinderte Österreich allerdings nicht daran, nach dem Ende der Besatzung 1955, den jahreszeitlich nicht fernen 26.Oktober zum Nationalfeiertag zu erklären. Mehr als sechzig Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, zu einem Zeitpunkt, wo sich große und epochale Umwälzungen ankündigen und die 1930-er Jahre mit ihren Fragestellungen näher zu sein scheinen als die 1970-er Jahre, ist der Staatsfeiertag der Ersten Republik uns näher, als der inhaltsleere Nationalfeiertag der Zweiten Republik. Alle wichtigen Fragen wurden schon einmal gestellt und falsch beantwortet. Die Geschichte lehrt uns, dass uns weder Plebiszite (Volksabstimmungen und Volksbegehren), noch starke Männer weiterbringen. Es geht um die Rehabilitierung der Politik, als eines Prozesses des Abwägens unterschiedlicher Positionen und der darauf aufbauenden Einigung auf Handlungsoptionen. Das Wesen der Demokratie besteht darin, dass jede und jeder von uns dabei gleich wichtig sind. Das haben schon die Totengräber der Ersten Republik nicht begriffen und so geschieht das auch heute.
Als ich diesen Montag zurück nach Brüssel kam, wurde ich von vielen Kolleginnen und Kollegen freudig begrüßt: „Toll habt ihr das in Wien gemacht. Das ist ein Signal für ganz Europa. Prinzipienfestigkeit zahlt sich aus.“ So, oder so ähnlich waren die Reaktionen. Natürlich freute ich mich darüber. Gleichzeitig kam aber Wehmut auf. Ich musste an die Wahlen in meinem Heimatbundesland OÖ vor zwei Wochen denken. Die FPÖ, die sich „soziale Heimatpartei“ nannte, hatte einen Erdrutschsieg errungen.
Heimat OÖ
Ich bin Oberösterreicher, mit Leib und Seele. Obwohl ich die meiste Zeit im Ausland unterwegs bin. Immer wenn ich zurückkomme, habe ich das Gefühl nach Hause zu kommen. Zu Hause sein, das bedeutet Vertrautheit und Zugehörigkeit. Ein schönes Gefühl. OÖ ist meine Heimat. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die eine Heimat haben. Ich weiß, dass ich immer zurückkommen kann. Der Familie wegen, der Freunde wegen, und weil die Berge nirgendwo so faszinierend sind, wie im Inneren Salzkammergut. Und nirgendwo gibt es einen so köstlichen Most. Ganz wenige Gegenden Europas verstehen sich darauf, aus Äpfeln und Birnen Wein zu bereiten. Nirgendwo schmeckt der Schweinsbraten, vor allem in seiner gesurten Version so gut. Und gar die Speckknödeln aus meiner innviertler Heimat. Unlängst habe ich sie einem koreanischen Kollegen zubereitet. Er sagte mir, dass er damit in Seoul großen Anklang fände. Schön. Aber ganz ehrlich, es gibt raffiniertere Küchen und edlere Getränke und auch die Berge sind vielerorts mächtiger.
Seine Heimat zu lieben, das bedeutet vor allem, das verlässlich wiederkehrende Normale zu schätzen, aber nicht, dies zum globalen Maßstab zu verklären. Auf diese Weise lässt sich auch das Besondere einer Gegend erfassen. An OÖ schätze ich den notorischen Hang, die Dinge pragmatisch zu sehen und die Fähigkeit, sachliche Lösungen zu finden. Das meiste ist unspektakulär und vorhersehbar. Das Prätentiöse liegt uns nicht unbedingt. Politische Auseinandersetzungen werden hierzulande meist nicht mit der feinen Klinge geführt. Die im politischen Betrieb allgegenwärtigen Intrigen sind im Gegensatz zur Bundeshauptstadt meist recht grobschlächtig. Bodenständigkeit ist eine hervorstechende Eigenschaft der Menschen in OÖ. Allerdings stellt dies nicht unbedingt einen Nachteil dar. Auf solchem Fundament und oft im Widerspruch dazu wächst mitunter Großes. Nicht von ungefähr wurde OÖ zum Exportmotor der Republik. Oberösterreichische Ingenieurkunst ist auf dem ganzen Globus geschätzt. Anton Bruckner, der Prototyp oö. Bodenständigkeit, gehört zum Repertoire aller Orchester dieser Welt, aber auch die zeitgenössische Kulturszene kann sich sehen lassen. Weit über OÖ hinaus.
OÖ ist eine Region, wo Widerspruch gedeiht. Seit jeher. Das beginnt mit dem unterschätzten Bauernführer Stefan Fadinger und reicht bis zu Richard Bernaschek und den Februarkämpfern des Jahres 1934. In OÖ gibt es ein weitverbreitetes Gerechtigkeitsempfinden und viele Sturköpfe, die sich – wenn einmal überzeugt – von nichts und niemanden abhalten lassen. Mostschädeln eben. In OÖ liebt man aber auch die ganz großen Dinger. Der Vierkanthof ist Sinnbild für diesen Hang zum Klotzen. Bescheidenheit ist keine hervorstechende Eigenschaft. Eher die Freude am Erfolg und die Bereitschaft auch darüber zu reden.
Erfolgstory OÖ
Oberösterreich ist eine Erfolgsstory. Zumindest seit ich auf der Welt bin, war das so. OÖ als Symbol für das aufstrebende Nachkriegsösterreich. Für jenes Österreich, das zum Erstaunen der Welt aus viel mehr als Walzerseligkeit, Sachertorte oder Kapuzinergruft besteht. Mehr als ein halbes Jahrhundert ging es steil aufwärts. Das ist in erster Linie dem Fleiß, der Tüchtigkeit und der Weltoffenheit seiner Menschen zu verdanken, auch wenn die Landespolitik das gerne anders inszeniert. Und es war im Besonderen auch unternehmerische Tatkraft und Risikobereitschaft. So wie der Steyrer Josef Werndl im 19. Jahrhundert haben sich nach dem Krieg mittelständische Unternehmer, die von einer Geschäftsidee besessen waren, hochgearbeitet und ihren Regionen Wohlstand und Stabilität gegeben. Und auch das sollte nicht vergessen werden, über lange Zeit waren verstaatlichte Unternehmen das Rückgrat des industriellen Oberösterreich. Viel kritisiert und gescholten und manchmal zu Recht. Aber ganz ehrlich, ohne die mutigen Entscheidungen in den 80er- und 90er-Jahren, dass der Staat Geld, und zwar ordentlich viel Geld in die Hand nimmt, würde es den Industriestandort OÖ von einer derartigen Bedeutung nicht mehr geben. Der Erfolg hat immer viele Väter und Mütter. Im Falle OÖs war das auch so. Besondere Standortvoraussetzungen, Menschen, die bereit und in der Lage sind, daraus etwas zu machen und Glück braucht man auch.
Die totale Vereinnahmung
Der oberösterreichischen Volkspartei ist es gelungen, den Eindruck zu erwecken, als wäre das alles nur ihr zuzuschreiben. Sie hat ihr politisches Kapital optimal eingesetzt und sich durch kluge Machtpolitik weit über ihr politisches Klientel hinaus Zustimmung sichern können. Mitunter ist das mehr als grenzwertig. Etwa, wenn sich das Logo der OÖVP und das des Landes kaum voneinander unterscheiden lassen. Eigentlich wäre das gar nicht notwendig. Aber diese grafische Gleichsetzung enthüllt gleichsam das Erfolgsgeheimnis. OÖ das ist „sepp-verständlich“ die ÖVP. Machterhalt als Primärtugend.


Mitunter geht es zulasten der Substanz, wenn die Prinzipienlosigkeit gleichsam zum Prinzip gemacht wird. Lange bevor Angela Merkel aus denselben Gründen die Sozialdemokratisierung der CDU betrieb. Schon in den 1920er-Jahren kritisierte die damalige christlich-soziale Politikerin Fanny Starhemberg den Opportunismus ihrer Partei, die sie mit der Leibspeise der Oberösterreicher, dem Bauerngeselchten verglich: außen schwarz und innen rot. Die heutige ÖVP unterscheidet sich davon nicht wirklich. Sie ist ein politisches Chamäleon, das seine Farbe je nach Situation wechselt. Der Farbwechsel dient bei Chamäleons bekanntlich der Kommunikation. Der OÖVP ist es grandios gelungen, zwischen Schwarz, Rot, Grün und Blau zu changieren. In der letzten Zeit war viel Blau im Einsatz. Der LH selbst gab bereits ein Jahr vor den Wahlen das Signal dazu und brachte die Einführung von Grenzkontrollen ins Gespräch. Aus heiterem Himmel. Aber was tut man nicht alles, um eine möglichst große Mehrheit zu bekommen. Diese schien zu diesem Zeitpunkt noch in Reichweite. Also warum nicht ein bisschen auf der rechtspopulistischen Welle mitschwimmen. Diese Welle war freilich so gewaltig, dass sie den Stimmenoptimierer immer weiter von seinem Ziel forttrug. Unaufhaltsam. Ein Chamäleon soll sich eben nicht auf ein Surfbrett wagen.
Das Ende der Sepp-Verständlichkeit
Diese Landtagswahlen zerstörten den Mythos ÖVP in OÖ. Definitiv und nachhaltig. Der gewaltige Materialeinsatz, mit dem sich die Partei Pühringers in den letzten Wochen gegen die drohende Niederlage stemmte, tat ein Übriges dazu. Nirgendwo konnte man dem Konterfei des Landeshauptmanns entkommen. Je mehr und je lauter die OÖVP vor einer Wahlniederlage warnte, desto mehr Menschen kamen auf die Idee, sie nicht zu wählen. Nicht nur des Flüchtlingsthemas wegen. Da hatten sich die oberösterreichischen Schwarzen mit ihrem opportunistischen Kurs selbst aus dem Spiel genommen. Mit den Ängsten der Menschen spielen, das können jene am besten, die das zu ihrem politischen Geschäft gemacht haben. Aber so mancher begann sich grundsätzliche Fragen zu stellen. Wieso war eine Partei, die so offensichtlich damit protzte, für Oberösterreichs führende Position verantwortlich zu sein, nicht willens, ein paar Hundert zusätzliche Flüchtlinge unterzubringen? Da half auch die Ausrede wenig, für die Unterbringung von Asylwerbern wäre (formal) der rote Regierungspartner zuständig. Weil im Hintergrund die faktische Macht vor allem darum bemüht gewesen war, die eigenen schwarzen Gemeinden zu „verschonen“. Eine Partei, die es der eigenen Propaganda nach schaffte, die „ganz großen Dinger“, wie Musiktheater oder medizinische Fakultät zu stemmen, sollte an ein paar Hundert Flüchtlingen scheitern?
Weil sie dieses opportunistische Spiel betrieb, trug die oö. Volkspartei maßgeblich zu ihrer Selbstdemontage bei. Das Liebäugeln mit populistischen Scheinlösungen trübt eben den klaren Blick. Politiker sollten den Menschen nicht einfach hinterherlaufen. Vielmehr sollten sie vorangehen und dafür werben, über die nächsten Wahlen hinauszudenken. Je länger die Ära Pühringer andauerte, desto mehr verfing sich die OÖVP, im Netz der Selbstgefälligkeit und begnügte sich, die Welt aus dem selbst gesetzten Rahmen, der primär mit Machterhalt zu tun hatte, zu erklären. Die eigene Propaganda wurde zunehmend mit der Realität gleichgesetzt. Auf diese Weise wird die Welt recht klein. Irgendwann kommt dann der Moment, wo die Zeit an einem vorbeizieht und Kritik nicht mehr als hilfreich, sondern als Ausdruck der Undankbarkeit empfunden wird.
Wenn Politik keine Antworten gibt
Oberösterreich ist eine Region, wo sich langfristige Veränderungen zu allererst bemerkbar machen. Das hängt mit seiner Struktur zusammen. Industrieregionen sind weitreichenden Veränderungsprozessen ausgesetzt. Zukunftsorientierte Politik kann sich nicht darauf beschränken, nur das Bestehende fortzuschreiben. Die Zukunftsfragen werden nicht durch mehr und ungehindertes Wachstum gelöst, sondern durch bewusste qualitative Entscheidungen für den Standort. Und die Politik sollte sich auch in Bescheidenheit üben und die Menschen wissen lassen, was sich auf regionaler Ebene gestalten lässt: relativ wenig. Alles andere ist Selbstanmaßung. In einem Staat, in dem das Landesfürstentum vorherrscht, ist diese Versuchung sehr groß. Pühringers ÖVP hat diese Selbstüberschätzung auf die Spitze getrieben. So wie die Vorväter. Sie haben als Zeichen ihrer selbstverständlichen Macht Vierkanthöfe in die Gegend gesetzt. Auch an diesen ist die Zeit vorbeigezogen. Veränderungen, noch dazu, wenn sie epochalen Charakters sind, wie der Übergang zu einer Industrie 4.0 dominierten Struktur, die zunehmend global bestimmt ist, produzieren Ängste. Vor allem dann, wenn sie nicht erklärt werden können und nicht durch soziale Sicherungsmaßnahmen abgefedert werden.
Das ist der Hintergrund dafür, warum das „Flüchtlingsproblem“ in diesem Sommer zum alles entscheidenden Thema wurde. Leider empfanden viele Menschen die Flüchtlinge als Bedrohung. Nicht nur, weil den Hetzern nichts entgegengesetzt wurde. Vor allem, weil die Verantwortlichen lange Zeit glaubten, das Thema totschweigen zu können. Die gelegentlichen populistischen Rülpser waren auch kein Zeichen von Lösungskompetenz. Viele Menschen fühlten sich alleine gelassen und nicht ernst genommen. Die ungewohnten Bilder von Zeltstädten und überfüllten Bahnhöfen, die Flut an Gerüchten und Lügen verstärkten die bereits vorhandenen Angstgefühle. Immer mehr wurden anfällig für einfache Erklärungen („die Muslime“) und Lösungen („Grenzen dicht“) und ließen ihren Gefühlen freien Lauf. Angst, Wut, Enttäuschung und Rachegefühle bestimmten das Wahlverhalten. Das Wahlergebnis war vor allem ein Nein: Nein zu den etablierten Parteien. Nein zu den tatsächlichen und vermeintlichen Bedrohungen. Nein zu den befürchteten negativen Zukunftsperspektiven. Ich bezweifle, dass die breite Masse der blauen Wählerschaft das Signal setzen wollte, den „Reformstau“ aufzulösen, wie uns das Leitl und Strugl neuerdings einreden wollen.
Profitieren von der Schwäche der anderen
Die FPÖ verstand es geschickt, diese Stimmung zu nutzen. Wie anders wäre es sonst möglich gewesen, dass Arbeiter in Scharen einer Partei zuströmten, die sich für den Abbau von sozialen Rechten starkmachte. Oder, dass die oö. Industriellenvereinigung eine Partei unterstützte, welche die EU und den Euro für alles Übel verantwortlich machten. Es wäre daher zu kurz gegriffen, das Wahlergebnis als Rechtsruck zu verstehen. Häufig wird behauptet, dass OÖ eine besondere Affinität zum Nazitum hätte. Von wegen Hitler, Kaltenbrunner oder Eichmann. Hitler war zwar Oberösterreicher. Aber sein Wirkungskreis war ein anderer. Und er wäre hier wohl nie Landeshauptmann geworden. Das trifft auch auf eine andere Galionsfigur der Rechten zu, die natürlich nicht mit ihm vergleichbar ist: Jörg Haider. Dessen Wirkungskreis erschloss sich bekanntlich in Kärnten. Aber natürlich gibt es auch in Oberösterreich ein rechtes Milieu in ungebrochener historischer Kontinuität. In meiner Innviertler Heimat ist das leider besonders ausgeprägt. Davon abgesehen passiert in OÖ aber nichts anderes als im übrigen Österreich. Eine von stramm-rechten Burschenschaftern beherrschte FPÖ hat sich darauf spezialisiert, die Ängste der Menschen aufzugreifen und politisch zu instrumentalisieren. Unsicherheit wird in Angst umgemünzt, durch regelrechte Hetzkampagnen verstärkt und auf Sündenböcke umgelenkt. Auf diese Weise wird die politische Richtung vorgegeben. Die etablierten Parteien haben das seit dreißig Jahren, als sich Jörg Haider an die Spitze der FPÖ geputscht hatte, nicht begriffen.
Die chronische Schwäche der Sozialdemokratie
Leider auch nicht die SPÖ. Die Frage ist berechtigt, warum in einer dynamischen Industrieregion wie OÖ die Sozialdemokraten bei regionalen Wahlen niemals wirklich reüssieren konnten. Bei Bundeswahlen ist das bekanntlich umgekehrt. Es liegt sicherlich nicht an den Parteimitgliedern, die verglichen mit anderen Bundesländern überaus engagiert und politisiert sind. Auch auf dem flachen Land. Auch jetzt noch. Schon eher liegt es an den strukturellen Voraussetzungen. Bis in die 90er-Jahre waren die Sitze in der Landesregierung fein säuberlich auf die drei Statutarstädte Linz, Wels und Steyr aufgeteilt. Ein Großteil der politischen Energie wurde dafür aufgebraucht, die unterschiedlichen Interessen im Gleichgewicht zu halten. Also nur niemanden zu einflussreich werden lassen. Und jede(r) nur in den zugewiesenen Bereichen. Personalentwicklung war und blieb ein Fremdwort. Die chronische Schwäche der Partei hat vor allem mit mangelnder Führungsstärke zu tun. Keinem der bisherigen Vorsitzenden ist es gelungen, die Partei als Nr.1 aufzustellen und professionellen Organisationsmethoden zum Durchbruch zu verhelfen. Alle waren sie bloß Getriebene. Nicht nur innerparteilich. Vor allem durch den Koalitionspartner ÖVP, wo sowohl Führungsstärke als auch zumindest ein gewisses strategisches Vermögen vorhanden war. Den sozialdemokratischen Obmännern ging es aber immer darum, ein möglichst guter Zweiter zu sein. Vorrangig war, nur ja nichts von den bisherigen Kompetenzen zu verlieren. Weil man sich jenen verpflichtet fühlte, die einen auf diese Position gesetzt hatten. In der Erwartung, auch in der künftigen Legislaturperiode ausreichend Zugang zu Landesmitteln zu erhalten. Taktik und nicht Strategie bestimmten den Kurs der oberösterreichischen SPÖ. Das ist auf Dauer zu wenig.
In der 70-jährigen Nachkriegsgeschichte gab es zwei Momente, wo man den Teufelskreis, ewig Zweiter zu sein, hätte durchbrechen können. 1967, als die SPÖ im Sog des Bundestrends unvermutet stimmenstärkste Partei wurde und nichts daraus machen konnte. Wahrscheinlich, weil man so überrascht war. Und 2003: Da konnte Erich Haider Stimmenzuwächse im zweistelligen Bereich erzielen. Dem war ein auf Inhalte konzentrierter Wahlkampf vorhergegangen. Im Kampf gegen die Privatisierung der VÖEST konnten tausende Mitglieder und Sympathisanten mobilisiert werden. Abermals gelang es nicht, diesen Erfolg in politische Gestaltungsmacht umzuwandeln. Indem die OÖVP ein Regierungsabkommen mit den Grünen erfolgreich als schwarz-grünes Koalitionsexperiment verkaufen konnte, wurde der Spielraum der Sozialdemokraten deutlich reduziert. Eine „Koalition“, von der man recht wenig merkte. Lediglich manche Stimmen aus dem Umfeld der Industriellenvereinigung, die die epochalen Veränderungen zweifelsohne registrierte, glaubte (in Verkennung der Ressortverteilung und die Megatrends fahrlässig ignorierend) darin den Kern des Übels zu erblicken: „Es war eine Koalition gegen das Volk, die überzogene Naturschutzmaßnahmen wie Luchs- und Elchkorridore durchgesetzt hat.” Die Regierungsbeteiligung der Grünen konnte wenig bewirken. Zu viel mehr, als Schnittlauch auf der schwarzen Nudelsuppe zu sein, reichte es nicht. Und dennoch sind die Grünen bei den Landtagswahlen der Sozialdemokratie recht nahegekommen. Auf zwei Sozialdemokraten entfällt ein Grüner.
Es ist nicht leicht, ein Sozialdemokrat in Oberösterreich zu sein. Ich habe das selbst intensiv, zur Genüge erlebt. Doch das ist etwas für ein andermal. Auf jeden Fall es ist nicht gut für das Land OÖ, dass sich die Sozialdemokratie nicht so entfalten konnte, wie das eigentlich hätte sein müssen. Ich denke an all die tausenden Frauen und Männer, die ich im Lauf der Jahre kennengelernt habe. Quer durch das Bundesland und quer durch alle sozialen Schichten. Zumeist waren es einfache Menschen, uneitel und positiv gesonnen, die bereit waren, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Ganz pragmatisch und zupackend, so wie es für OÖ typisch ist. Geradlinige Menschen, die stolz auf ihre Gesinnung sind. Nur auf kommunaler Ebene war es diesen Menschen möglich, sich einzubringen. Sonst sah es für eine(n) Rote(n) ziemlich schwarz aus. Diese Menschen, die das Fundament einer guten Demokratie sind, gibt es aber nicht nur in der Sozialdemokratie. Auch in anderen Parteien, in Kirchen und der muslimischen Community, in Vereinen und seit der Flüchtlingskrise auch auf Bahnhöfen und Notunterkünften. Viele wollen mitgestalten und können sich nur beschränkt entfalten.
Was nun?
Wenn wir aus dem Wahldesaster lernen wollen, dann müssten wir alles tun, diesen Menschen Gehör zu verschaffen. Dann müssten wir daran gehen, ganz im Sinne der oberösterreichischen Tradition der Widerständigkeit, dem Landesfürstentum zu Leibe zu rücken. Dann müssten wir beginnen, den hypertrophen Machtapparat auf Landesebene abzubauen. Vor allem müssten wir dem Föderalismus, der zur zerstörerischen Zentrifugalkraft in dieser Republik geworden ist, ordentlich die Flügel stutzen. Dazu braucht es eine breite Koalition von reformwilligen Menschen. Eine erneuerte Sozialdemokratie könnte dabei eine wichtige Rolle spielen.
Erwin Pröll versteht ihn, Wolfgang Schüssel schätzt ihn und Horst Seehofer lädt ihn ein. Die Rede ist von Viktor Orbán. Der ungarische Ministerpräsident ist gegenwärtig drauf und dran, die EU zu zerstören. 25 Jahre nachdem sein Amtsvorgänger Gyula Horn den Stacheldrahtzaun durchtrennte, ließ er an der Grenze zu Serbien einen neuen errichten. Nicht nur um Flüchtlinge abzuhalten. Vielmehr gibt er vor, das „christliche Ungarn“ vor einer islamischen Invasion zu schützen. Die Europäische Kommission konnte ihn nicht davon abhalten. Ihre Warnungen blieben auffallend vage. Wohl auch deswegen, weil sich manche bereits innerlich mit seiner Existenz abgefunden, oder sogar klammheimlich mit ihm angefreundet haben.
Orbáns Freunde
Nicht wenige äußerten im Vorfeld der Maßnahmen sogar Verständnis. So der glücklose Obmann der christlich-sozialen ÖVP, die sich bis vor Kurzem noch stolz als Europapartei präsentiert hatte. Für Reinhold Mitterlehner ist mittlerweile ein „Konflikt mit Orban absolut sinnlos“. Fragt sich bloß: warum? Es wird wohl nicht nur die Sorge, um die im Nachbarland prominent vertretenen österreichischen Banken sein? Und auch nicht die Erkenntnis, dass das Gesetz des Handelns gegenwärtig beim Puszta-Putin zu liegen scheint. Da muss schon eine gewisse Grundsympathie vorhanden sein. So wie bei vielen Parteifreunden in der EVP auch. Dort ist FIDESZ nach wie vor Mitglied. Orbán wird mit Samthandschuhen angefasst und Kritik wird nur hinter verschlossenen Türen geäußert. Was macht Viktor Orbán für viele Konservative so unverzichtbar? Machtkalkül? Vielleicht. Aber auch ohne FIDESZ wäre die EVP noch immer Nr. 1 im Europaparlament. Viktor Orbán ist in der Europäischen Volkspartei durchaus umstritten. Manche hassen ihn und noch mehr fürchten ihn. Nicht wenige verehren ihn. Er ist der Prellbock, hinter dem man sich verstecken kann. Einer für die „Dirty Jobs“, über die man nicht gerne redet, die man aber mitunter für notwendig erachtet. Darum wird man ihn auch nicht fallen lassen. Ich behaupte, dass Orbán deswegen so wichtig ist, weil er eine potenzielle Option bedeutet. Eine Art „Wildcard“ für Zeiten, wo der neoliberal verzerrte marktwirtschaftliche Grundkonsens der europäischen Eliten an Legitimität einbüßt. Man braucht bloß miteinander zu vergleichen, wie der pro-europäische und moderate Fraktionsvorsitzende der EVP, Manfred Weber behutsam mit Viktor Orbán umgegangen ist und wie harsch er ein paar Wochen später Alexis Tsipras attackierte. Das ist auch die rote Linie für viele in der EVP. Solange die Sozialdemokratie überall brav mitmacht, ist eine Zusammenarbeit mit ihr zweifellos zu bevorzugen. Einen grundsätzlichen Kurswandel – weg von der Fixierung auf Austerität und Privatisierungsdogma – würde man aber nur ungern akzeptieren. Es ist also vorrangig ein taktisches Spiel. Die EVP braucht Orbán. Und umgekehrt braucht Orbán auch die EVP.
Politik als Business
Orbán ist ein Jahrhundertpolitiker. Zumindest aus ungarischer Sicht. Er versteht sein Geschäft. Und das ist wörtlich zu nehmen. Die Verteilung von EU-Geldern dient dem Ausbau und der Zementierung der politischen Macht. Und sie rechnet sich für Orbáns Familie und Freunde. Immer wieder müssen sich die EU-Institutionen mit dem Verdacht der missbräuchlichen Verwendung europäischer Gelder beschäftigen. Zuletzt im Fall der Vergabe ehemals staatlichen Pachtlandes. Manches ist in der Tat verwunderlich. Die Mühlen der europäischen Kontrollinstanzen mahlen freilich recht langsam. Aber irgendwann kommt alles ans Licht. Mit einer gewissen Berechtigung kann man darauf hoffen. Weil es nicht akzeptabel ist, dass EU-Gelder so kanalisiert werden können, dass sie vorrangig der Verfestigung der Machtposition einer kleinen Gruppe dienen. Ohne die EU-Milliarden gäbe es praktisch keine öffentlichen Investitionen in Ungarn. Die öffentliche Auftragsvergabe ist so konstruiert, dass sie als Füllhorn Orbánscher Wohltaten empfunden wird. Würde die EU strengere Maßstäbe anlegen, dann wäre das Kapitel Orbán sehr schnell Geschichte.
Machterhalt mit allen Mitteln
Schon einmal wurde es recht knapp für Orbán. Das ist noch kein Jahr her. Korruptionsvorwürfe häuften sich, Nachwahlen wurden verloren und immer mehr Menschen gingen auf die Straße. Orbán war angezählt und musste einen schleichenden Machtverlust befürchten. Der Verlust politischer Macht hätte natürlich sein Geschäftsmodell gefährdet. Das musste verhindert werden. Mit Recht sehen viele Beobachter in der ungarischen Flüchtlingskrise eine bewusste Eskalationsstrategie Orbáns. Seit Jahresbeginn, seit dem Anschlag auf Charly Hebdo verfolgte er einen Kurs, der eine Bedrohung Ungarns durch islamistische, mit terroristischen Gruppierungen sympathisierende Horden heraufbeschwor. Das „liberale Blabla“ der EU-Eliten wäre nicht geeignet, das zu verhindern. Da müsse Ungarn zur Selbsthilfe greifen. Eine Volksbefragung auf der Basis eines suggestiven Fragebogens wurde durchgeführt. Großflächenplakate – sinnvollerweise in ungarischer Sprache – forderten die Migranten auf, nicht in Ungarn zu bleiben und schließlich wurde mit dem Bau eines Zauns zu Serbien begonnen. Die Situation geriet aus den Fugen. Nun konnte er sich, wie geplant, nach seinem Geschmack inszenieren: Orbán als Retter Ungarns, Orbán als Verteidiger des Abendlandes, Orbán als Mann der Tat, der die liberalen Weicheier in Brüssel vor sich hertreibt. Das Spiel ist aufgegangen. Seine Beliebtheitswerte im Inland sind gestiegen. Seine, ebenfalls unter innenpolitischem Druck stehenden Nachbarn beginnen, ihn zu kopieren und für alle europaskeptischen Strömungen am rechten Rand ist er mittlerweile zum Helden mutiert.
Orbáns Programm heißt Orbán
Ist Orbán ein rechter Ideologe? Viele seiner Äußerungen würden diesen Schluss nahelegen. Seine Absage an die „liberale Demokratie“ oder sein bizarres Plädoyer für die ungarische Nation. Aber Orbáns Antrieb ist nicht so sehr ideologischer Natur, es ist sein ausgeprägter Machttrieb, der sich ideologische Positionen nach dem Opportunitätsprinzip zu eigen macht. Orbáns Ultima Ratio heißt Orbán. Und sein Problem ist die Unberechenbarkeit demokratischer Entscheidungen. Nur schwer verkraftete er, als er 2002 schon nach einer Periode aus dem Amt des ungarischen Ministerpräsidenten gewählt wurde und auch 2006 überraschenderweise nicht reüssieren konnte. Gegen die verhassten Sozialisten setzte er daher auf eine gnadenlose Oppositionspolitik, verteufelte Ferenc Gyurcsány wegen dessen „Lügenrede“ und begann auf dem Klavier des Nationalismus zu spielen, auch um den Preis, damit die rechtsradikale Jobbik ins politische Spiel zu bringen. Er wollte weg vom angelsächsischen Demokratiemodell. Viel wurde über Gyurcsánys Geheimrede geschrieben. Weniger bekannt ist Orbáns Geheimrede, ein Jahr vor seinem triumphalen Wahlsieg 2010. Dabei versprach er, dem „dualem Parteihader“ ein Ende zu bereiten und seine Partei im „zentralen politischen Kraftfeld“ für die kommenden 15 bis 20 Jahre „zum allein herrschenden Machtfaktor zu machen.“ Wieder an die Macht gelangt, sollte nichts dem Zufall überlassen bleiben. Vor allem sollte – wie in westlichen Demokratien üblich – verhindert werden, dass das Pendel wieder zurückschlägt. Der überwältigende Wahlerfolg, der nicht zuletzt deswegen zustande gekommen war, weil die Linke regelrecht kollabierte, brachte Orbán aufgrund des damals in Ungarn geltenden Mehrheitswahlrechts eine 2/3 Mehrheit der Mandate. Dieses Momentum nutzte er für einen radikalen Umbau Ungarns zu einem autoritären Staat: unbeirrt, unnachgiebig, alle Widerstände aus dem Weg räumend. Von der Europäischen Union ließ er sich schon gar nicht davon abbringen. Der LIBE-Ausschuss des EP (Tavares-Report) stellte zwar eindeutige Verletzungen der Grundrechte fest. Das blieb freilich ohne Folgen. Orbán machte ein paar Schritte zurück und überbot sich gleichzeitig in nationalistischer Rhetorik. Wesentlich war für ihn bloß, nicht von den europäischen Futtertrögen abgeschnitten zu werden. Das gelang und damit auch der nächste Wahlerfolg. Dieser fiel zwar verhaltener aus als vier Jahre zuvor, erlaubte aber, im selben Stil fortzufahren. Großzügig hatte Orbán das Wahlrecht geändert, die Wahlkreise nach seinen Bedürfnissen zugeschnitten und Hunderttausende, für nationalistische Parolen besonders anfällige, ethnische Ungarn aus den benachbarten Ländern zu Staatsbürgern erklärt und damit zu Wahlberechtigten gemacht. Somit konnte er, wie geplant, ein System schaffen, das einen Machtverlust sehr unwahrscheinlich macht. Das alles widerspricht eindeutig dem westlichen Grundverständnis von Demokratie. Aus diesem Grund ist es nur naheliegend, dass sich Orbán nach gewonnener Wahl bei seiner berühmten Rede auf der Sommeruniversität im siebenbürgischen B?ile Tu?nad von der liberalen Demokratie lossagte. Dabei erklärte er unmissverständlich, mit der EU als einer Wertegemeinschaft und mit den darauf basierenden Kopenhagen-Kriterien, zu deren Einhaltung sich Ungarn beim EU-Beitritt verpflichtet hatte, nichts zu tun haben zu wollen: „Dass eine Demokratie nicht notwendigerweise liberal sein muss. Etwas, das nicht liberal ist, kann noch eine Demokratie sein.“
Orbáns autoritäre Vorbilder – alles ist möglich
Orbán verachtet nicht nur die europäische Wertegemeinschaft. Er bezweifelt auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU: „Die „Stars” der internationalen Analysen sind heute Singapur, China, Indien, Russland, die Türkei.“ Eine ziemlich krude Analyse. Diesen Vorbildern müsse die ungarische Nation nacheifern: „Wir müssen uns von den in Westeuropa akzeptierten Dogmen und Ideologien lossagen und uns von ihnen unabhängig machen ….. den neuen ungarischen Staat finden, der imstande ist, uns im großen Wettlauf der Welt wettbewerbsfähig zu machen.“ Ungarns Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der EU hat sich drastisch verschlechtert. Daher ist Orbáns Benchmark auch nicht mehr der europäische Binnenmarkt. Er beklagt sogar die starke Verflochtenheit der ungarischen Wirtschaft mit der EU. Seine Vorbilder heißen mittlerweile Putin, Erdogan, Gruevski, Alijew & Co. Ein in der letzten Zeit immer häufiger auftretender autoritärer Politikertypus, dessen primäres Ziel, die Optimierung privaten Vermögens ist. Kleptokratie nennt man solche autoritären Systeme. Ungarn ist demnach auf dem Weg zu einem kleptokratischen Ständestaat. Da geht es nicht mehr primär um Ideologie, wie bei den autoritären Potentaten des vorigen Jahrhunderts, Franco, Pinochet & Co. Ideologie ist nur dann wichtig, wenn dies der Machterhaltung dienlich ist. Ebenso geschmeidig, geradezu pragmatisch ist der Umgang mit demokratischen Institutionen und Verfahren. Solange sie nicht hinderlich sind, bedient man sich ihrer. Nicht zuletzt deswegen, um vom wahren Charakter der Herrschaftsausübung abzulenken. Jene europäischen Politiker, die Orbán hofieren und verteidigen, sollten sich diese Zusammenhänge vor Augen halten. Sie sollten sich fragen, was diesen Mann, der ihre Freundschaft missbraucht, denn bewegt. Vielleicht wird ihnen dann auch klar, dass sie mit dieser Nibelungentreue zur Destabilisierung der EU beitragen. Und sie sollten unbedingt Orbáns zitierte Rede aus dem Vorjahr lesen. Vor allem seine abschließenden Bemerkungen. Sie sind unglaublich lächerlich und gleichzeitig bedrohlich. In gewisser Weise haben sie im Hinblick auf die tragischen Ereignisse dieses Sommers sogar prophetischen Charakter: „Das Wesen der Zukunft ist Folgendes: Alles kann passieren. Und „alles” ist ziemlich schwer zu definieren“. Auf jeden Fall böte diese Analyse für die „ungarische Gemeinschaft im Karpatenbecken und auf der ganzen Welt“ die historische Chance „durch Mut, voraussehendes Denken und vernünftiges, aber tapferes Handeln“ zu neuer Bedeutung zu gelangen. „Nachdem alles geschehen kann, ist es leicht möglich, dass unsere Zeit kommt.“ P.S.: Liebe Freunde in der EVP, mit so jemandem ist kein Staat zu machen. Je früher ihr euch davon abgrenzt umso besser.
In den Geschichtsbüchern wird dieser Herbst einmal einen ähnlich bedeutenden Platz einnehmen wie jener des Jahres 1989. Damals fielen die Berliner Mauer und der Eiserne Vorhang. Diesmal ist die Festung Europa ins Wanken geraten. Noch wissen wir nicht, ob dies wirklich passieren wird. Schon gar nicht kennen wir die Auswirkungen. Noch spielt sich alles im Rahmen der bestehenden Institutionen und des für Migration und Zuwanderung vorgesehenen Rahmens, Schengen und Dublin ab. Die Geschehnisse an diesem Wochenende in Budapest und in Wien haben uns klar gemacht, dass Dublin tot, Schengen fragil und die EU insgesamt gefährdet ist. Ich war erst vorletzte Woche unterwegs an Stationen der Flüchtlingsbewegung von Südost nach Nordwest: von Thessaloniki über den mazedonischen Grenzort Gevgelija bis Preševo in Serbien. Dort treffen täglich tausende Menschen ein. Mehr als zwei Drittel Kriegsflüchtlinge aus Syrien, viele auch aus dem Irak, Afghanistan oder Pakistan. Unter den Menschen, die in diesen Tagen am Westbahnhof begrüßt werden, sind sicher viele, denen ich bei meinem Augenschein begegnet bin.
Station Griechenland: Überforderung, kein Rettungspaket für Menschen
Griechenland ist seit Langem nicht mehr fähig, mit den ständig zunehmenden Flüchtlingszahlen zurande zu kommen. Nach dem Dublin-Übereinkommen wäre es dazu verpflichtet. Wie auch? Das kaputtgesparte Land ist dazu schlichtweg nicht mehr in der Lage! Es fehlt an allem: am Geld die Menschen zu versorgen, an Medikamenten, Verbandszeug und Personal. Wo bleiben hier die Millionen für ein Rettungspaket für Menschen? Für die meisten ist der Grenzübergang Idomeni die einzige Möglichkeit in jenen Teil der EU zu gelangen, wo es noch einigermaßen Zukunftschancen gibt. Besonders die Grenze zu Mazedonien war bislang ein schwer überwindbares Hindernis.
Station Mazedonien: Die Mafia agiert – wann reagiert Europa?
Nach dem Verlassen Griechenlands muss man durch einen halben Kilometer breiten Streifen Niemandsland, der von der Mafia kontrolliert wird. Nur wenn man zahlungswillig ist, kann man bis zur mazedonischen Grenze gelangen. Diese Dinge sind seit Langem bekannt. Der griechische Aktivist Vasilis Tsartsanis dokumentiert diese Machenschaften und berichtete schon im April 2015 bei einer von mir organisierten Veranstaltung im Europäischen Parlament davon. In der Folge erschienen Artikel in der internationalen Presse. Spätestens dann müssten die mazedonischen Grenzbehörden davon Kenntnis erlangt haben. Aber ist es nicht absurd, dass der Polizei solch systematische Gesetzesverletzungen über einen so langen Zeitraum überhaupt nicht auffallen? Der Verdacht, das Ganze könnte unter Duldung und Mitwissen der Regierung in Skopje passiert sein, ist plausibel. Zudem auch die Passage durch das Land von ähnlichen Vorkommnissen begleitet ist. Zunächst sind die Menschen zu Fuß oder per Fahrrad durch das Land gezogen. Nunmehr verlagert sich das alles auf Taxis, Busse und den Zug nach Belgrad. Offiziell wird versichert, Transfers seien gratis. Fakt ist, den Flüchtlingen wird dafür Geld abgenommen (30 Euro und mehr). Wasser und Lebensmittel werden zu unverschämt überhöhten Preisen angeboten und kosten das Dreifache, was Einheimische bezahlen.
Station Serbien: Ein offenes Herz und ehrliches Bemühen, aber es fehlt an Unterstützung
Erst auf der serbischen Seite habe ich das Gefühl, dass man sich bemüht, gewisse Rechtsstandards einzuhalten. Ein Übertritt nach Serbien kann allerdings drei Tage dauern: Feststellung der Identität, Fingerabdrücke, Gesundheitscheck & Co. Hat man endlich ein serbisches Dokument bekommen, kann man sich 72 Stunden lang frei bewegen. Dann muss man entweder das Land verlassen oder um Asyl ansuchen. Freilich mangelt es hier an allem. Kein Personal und kein Geld. Mehr als 3000 Menschen passieren täglich diesen topografischen Flaschenhals. Wie lange wird Serbien diese Politik durchhalten können? Der vom Ultranationalisten zum Demokraten und Europäer gewandelte Premier Aleksandar Vu?i? hat klare Vorstellungen: „Wir sprechen hier von verzweifelten Menschen, nicht über Kriminelle oder Terroristen.“ Ich war sehr angetan von der Atmosphäre in Preševo. Wenn es um die Flüchtlinge geht, ist nichts mehr von den Spannungen zwischen Serbien und der albanischen Mehrheitsbevölkerung zu spüren. Alle helfen. Ich hatte das Gefühl, als wäre da glatt ein Strahl der Hoffnung in den Gewitterwolken, die sich über Europa zusammenziehen, zu sehen gewesen.
Die große Flucht – alles schon dagewesen
Ob Serbien, Mazedonien, Griechenland: Ich kriege all diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Das Gedränge, die überall spürbare Hast. So muss es gewesen sein, als die Menschen nach 1945 Hals über Kopf ihre Heimat verlassen mussten. Nicht nur „Volksdeutsche“. Aber mit denen hatte ich in meiner Kindheit zu tun. Bis zu meinem Schuleintritt lebten zwei Flüchtlingsfamilien in meinem Elternhaus. Die einen waren Donauschwaben, die andere Familie aus Schlesien. Zur Schlesierin, die den Bahnschranken im Dorf bediente, hatte ich eine besondere Zuneigung. Durfte ich sie doch bei ihrer Arbeit begleiten. Sie war sehr gesprächig. Hin und wieder sprach sie über ihre Flucht aus dem heutigen Polen. Beim Wort „Flucht“, dessen Bedeutung ich damals nicht verstand, wurde sie auf eine ganz eigene Weise unruhig. Jahrzehnte habe ich nicht mehr daran gedacht. In Mazedonien ist mir plötzlich dieses Bild eingefallen. Und ich sah viele Menschen, die diese Angst, diese Erschütterung der Bahnwächterin aus meiner Jugend mit sich trugen. Wer in einer solchen Situation von „Wirtschaftsflüchtlingen“ redet, der ist entweder einer von ideologischen Vorurteilen befallener Ignorant oder ein böswilliger Hetzer. Diese Menschen sind Wochen unterwegs, ihr Hab und Gut in einem Rucksack verpackt, der Witterung ausgesetzt. Es war immer noch heiß. Ich sah Warteschlangen, die der prallen Sonne ausgesetzt waren stundenlang. Wenn es regnet, ist es ähnlich schlimm. Es gibt keinen Schutz und wenig Menschlichkeit. Wenn nicht die vielen einfachen Menschen wären, die spontan helfen und die Schwachen unterstützen. Überall, in Idomeni, Gevgelija oder Preševo. Gerade dort, wo es schwierig ist und oft auch die einheimische Bevölkerung Not leidet.

Station Ungarn: Wegen Populismus geschlossen
Bis vor wenigen Wochen zog der Flüchtlingstreck über Ungarn Richtung Westeuropa. Transitland Ungarn. Wegen Dublin III war es zwar der offizielle Ort, ein Asylansuchen zu stellen, viele versuchten aber gleich nach Österreich oder Deutschland weiterzureisen. Von den 45.000 Menschen, die 2014 in Ungarn um Asyl ansuchten, wollten gerade 500 in Ungarn bleiben. Von einer Überschwemmung Ungarns durch „Wirtschaftsflüchtlinge“, die in der Terminologie Orbans aus „den Tiefen Afrikas und Asiens” kommen, in der Hoffnung, „schneller ein schönes Leben zu haben”, kann hier also keine Rede sein. Die Zahl der Transitflüchtlinge durch Ungarn ist nicht gering zu reden. Sie stellt aber auch kein existenzielles Problem dar. Vielmehr eines, das sich durch gesamteuropäische Kooperation hätte lösen lassen. Orban allerdings war nur am Brüsseler Geld und nicht an einer solidarischen Kooperation interessiert. Da war er sich mit seinen Kollegen aus den Visegrad-Staaten (Tschechien, Slowakei und Polen) einig. Für Orban, den Meister des Double-Speak und der Schaukelpolitik bedeutete das hochgeredete Flüchtlingsproblem die große Chance, seine durch Korruptionsskandale schwer angeschlagene Position zu verfestigen. Kein Land der EU, außer Griechenland verarmte in den letzten Jahren so schnell wie Ungarn und nirgendwo ist die extreme Rechte (Jobbik) so aggressiv und präsent wie in Ungarn. Orban packte den Stier an den Hörnern und machte das Migrationsthema zur Chefsache. Seit „Charly Hebdo“ wurde er nicht müde, von einer Bedrohung durch islamische Terroristen, von islamischer Unterwanderung und völkischer Bedrohung zu faseln. Integrationsunwillige Massen an Einwanderern, von denen allerlei Infektionsrisiken ausgingen, würden das ungarische Volk in seiner Substanz gefährden. Orban ging dabei systematisch vor. Zunächst wurde die Bevölkerung aufgestachelt. Plakatkampagnen und eine suggestive Volksbefragung bereiteten den Boden auf für den Bau eines Grenzzauns zu Serbien, eine spektakuläre Maßnahme, die ihm internationale Aufmerksamkeit und das erwartete Chaos bescherten. Wie ein Turbo beschleunigte diese Maßnahme den Flüchtlingstreck auf der Balkanroute und schuf ein innenpolitisches Klima, das es ihm erlaubte, quasi über Nacht Notstandsgesetze zu verabschieden. Letzten Freitag, am 4. September 2015 wurde Ungarn zu einem semi-autoritären Staat, zum Ersten in der EU. Von der europäischen Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Diese beschäftigte er geschickt mit Bildern vom Chaos am Budapester Keleti Bahnhof und auf der ungarischen Autobahn. Am liebsten wäre es ihm gewesen, Brüssel und der EU Handlungsunfähigkeit vorwerfen zu können. Das herzhafte Einschreiten von Werner Faymann und Angela Merkel verhinderte das. Auch schon etwas. Sehr viel sogar.
Station Wien: Hetzen und Ertrinkenlassen ist plötzlich nicht mehr cool
Es ist beeindruckend, was sich in den letzten Tagen überall in Österreich abgespielt hat. Darauf können wir stolz sein. Österreich, wie es sein sollte und wie es in meiner Erinnerung auch immer war: 1956, als wir 200.000 Ungarn willkommen hießen, 1968 nach der Niederschlagung des Prager Frühlings und 1981 nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen. Immer wieder waren wir großzügig und gastfreundlich. So wie jetzt. Auch wenn damals mehr Flüchtlinge in Österreich geblieben sind. Was mag in diesen Menschen vorgehen, wenn sie nach beschwerlicher Flucht plötzlich Menschen begegnen, die sie freudig willkommen heißen. Sie werden noch lange daran denken, vor allem dann, wenn sich die ersten Schwierigkeiten in der neuen Heimat zeigen. Die letzten Tage waren aber auch deswegen so aufbauend, weil wir so viele waren. Ich habe Menschen getroffen, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass sie so denken wie ich. Vielen ist es so gegangen. Nach diesem Wochenende werden sich die Menschen diese dauernde Hetzerei wahrscheinlich nicht mehr so ohne Weiteres gefallen lassen. Ja und es gibt auch Hoffnung. Vor drei Wochen meinte ich in meinem Blog „Die Traiskirchner Republik“: „Bewegen wir uns in eine autoritäre Richtung so wie in Ungarn? Oder gelingt am Ende doch ein demokratischer Neuanfang. Ob das gelingt, hängt davon ab, wie die gegenwärtige Situation gelöst wird.Gerade jetzt wäre es für die staatstragenden Parteien wichtig, auf diese Menschen zuzugehen. Weitaus wichtiger als das Schielen auf verantwortungslose Hetzer und Demagogen. Also auf die Rücksichtsvollen Rücksicht nehmen und nicht auf die Rücksichtslosen.“ Zum ersten Mal seit Langem bin ich wieder zuversichtlich. Aber nur ja keine Euphorie aufkommen lassen.
Mit dem Herzen allein lässt sich die Flüchtlingsfrage nicht lösen
Es besteht dringender Handlungsbedarf. Und ich freue mich schon auf die kommende Woche in Straßburg. Sie wird nicht langweilig sein. Ich habe mich mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Fraktionen für Montag verabredet, nochmals die Situation in Ungarn anzugehen und Aktionen gegen Orbans permanente Provokationen zu setzen. Vor allem wird die Flüchtlingsfrage zur Debatte stehen. Jean-Claude Juncker wird in seiner „State of The Union“-Rede am Mittwoch klarmachen, welche Schritte die Kommission setzen wird. Er wird mit heftiger Kritik rechnen müssen. Wir werden ihn aber auch bei allen konstruktiven Bemühungen unterstützen. Auch wenn es darum geht, den egoistischen Widerstand Einzelner zu brechen. Die gegenwärtige Herausforderung kann nur gesamteuropäisch beantwortet werden. Durch ein gerechtes Quotensystem und die Schaffung legaler Einreisekorridore. Und das wird alles nichts nützen, wenn wir nicht bereit sind, die Länder, die am meisten Flüchtlinge beherbergen, wie Libanon, Irak oder Jordanien bei dieser Aufgabe großzügig zu unterstützen. Was bisher äußerst ungenügend geschieht. Im Irak stehen nicht einmal 10% der benötigten Mittel zu Verfügung. Vor allem aber muss Europa mit allen zur Verfügung stehenden diplomatischen Mitteln dazu beitragen, die Konfliktzonen im Irak, in Syrien, Libyen oder am Horn von Afrika zu stabilisieren. Deswegen müssen wir den Kampf mit dem IS ernst nehmen und ihn mit Entschiedenheit führen. Wer kann jemanden verübeln, dass er/sie versucht, dieser terroristischen Gewaltherrschaft zu entfliehen. Darum geht es. Die meisten Menschen wollen in ihrer Heimat bleiben, aber es gibt eben Umstände, die sie zwingen, diese zu verlassen. Das ist – ganz unaufgeregt beschrieben – das gegenwärtige Problem. Daher kann das Problem auch nicht im Alleingang von Nationalstaaten und schon gar nicht aus der Kirchturmperspektive einzelner Landeshauptleute gelöst werden, sondern nur durch eine gemeinsame, gewaltige Kraftanstrengung Europas und der internationalen Gemeinschaft.
EUpdate 09/2014 »Flucht nach Europa«
Like Joe auf Facebook | Folge Joe auf Twitter
Eine gute Woche lang habe ich recht wenig vom politischen Geschehen mitbekommen. Ein großes Familienfest hatte mich in Beschlag genommen und die Welt rund um mich beinahe vergessen lassen. Mein Nachrichtenkonsum war auf ein Minimum beschränkt. Das private Interesse dominierte meine Aufmerksamkeit. Schöne Tage in jeder Hinsicht. Gerne wäre ich noch eine Zeit lang in diesem Biedermeier Idyll verharrt. Aber es geht nicht, wenn man weiß, dass die Welt rundherum brennt. Der Amnesty Bericht über Traiskirchen hat mich endgültig aus meiner sommerlichen Lethargie gerissen. Natürlich haben wir das alle irgendwie gewusst. Der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler hat diese Dinge schon lange schonungslos kritisiert, auch NGOs und Medien sind in den letzten Wochen immer wieder mit erschütternden Informationen an die Öffentlichkeit getreten. Aber das alles in einem Bericht zusammengefasst bedeutet: Wenn es um Menschenrechte für Flüchtlinge geht, ist Österreich offensichtlich eine Bananenrepublik.
Mit ein bisschen politischem Willen und mit ganz wenig finanziellen Mitteln ließe sich dieser skandalöse Zustand sofort beheben. Heinz Patzelt, der Generalsekretär von AI-Österreich sprach daher treffend von einem „selbst erzeugten Pseudo-Notstand“. Warum das so ist? Ein ausgeprägter Dilettantismus der politisch Verantwortlichen auf Bundes-und Länderebene gepaart mit notorischer Ignoranz (Flüchtlinge wählen ja nicht) ist sicherlich im Übermaß vorhanden. Aber diese Erklärung reicht nicht. Es steckt Vorsatz dahinter. Einerseits sollen die nach Österreich „strömenden“ AsylwerberInnen abgeschreckt und andererseits die für die Quartierbeschaffung zuständigen Bundesländer zu größeren Anstrengungen motiviert werden. Ein beschämendes Schwarzes-Peter-Spiel auf dem Rücken der Asylwerbenden. Ja, und dann gibt es noch ein besonders niederträchtiges Kalkül. Manche glauben, damit politische Punkte sammeln zu können. Sie versuchen auf der Welle einer vorsätzlich herbeigeführten, zunehmend rassistische Züge tragenden Fremdenfeindlichkeit zu schwimmen. Das ist pure Dummheit. Nur die Dummen gießen bekanntlich Öl ins Feuer. Die Bilder von Asylwerbern in der berühmten Zeltstadt, die auf dem Sportplatz der Linzer Polizei Mitte Mai aufgebaut wurde, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Stimmung gekippt ist und offene Hetze salonfähig wurde. Die Menschen sind bei den darauf folgenden Landtagswahlen in der Steiermark und im Burgenland in Scharen der FPÖ zugelaufen. Das war eine historische Zäsur.
Seither sind fast drei Monate vergangen. Die Zeltstadt gibt es nicht mehr. Dafür geht es in Traiskirchen skandalös weiter, obwohl es eine offizielle Aufnahmesperre gibt. Und von Tag zu Tag wird die Stimmung aggressiver. Zum Davonlaufen, wenn da nicht die tausenden Menschen überall in Österreich wären, die ein offensives Zeichen der Solidarität setzen, Flüchtlinge beherbergen und unterstützen, sie mit dem Notwendigen ausstatten und den Hetzern mutig entgegentreten. Was mich wirklich empört ist das dröhnende Schweigen der politisch Verantwortlichen. Der Kopf tut mir weh, ob dieser Stille. Dieser prinzipienlose Opportunismus ist nicht auszuhalten. Nur nicht anstreifen, nur nichts sagen, nach dem Motto: „Hände vor die Augen, wie kleine Kinder, die sich dann nicht mehr vor dem Gespenst fürchten.“ Das hat mich schon immer maßlos aufgeregt. Anfang der 90er als die damals Verantwortlichen in der Löwelstraße plötzlich proklamierten, das Boot wäre voll. Mitte der 90er, nach der Wahlniederlage 1994 als eine von Vranitzky angeregte Arbeitsgruppe der Partei zur „Ausländerintegration“, an der ich federführend beteiligt war, nach drei Sitzungen sanft entschlief. Ende der 90er dann, als Haider, so wie jetzt Strache von Sieg zu Sieg eilte, als man uns erklärte, es wäre am besten, das Thema totzuschweigen. Usw. usf.
Immer wieder habe ich es probiert, dieses Schweigen aufzubrechen, in meiner Volkshilfe, in der Gewerkschaft und in der Partei. Unten an der Basis, also dort, wo ein erfolgloser Parteivorsitzender die „Wappler“ verortete, habe ich das größte Interesse vorgefunden. Die Menschen waren gierig nach Information und danach, jemandem ihre Probleme erzählen zu können. Das waren intensive und mitunter recht kontroversielle Diskussionen, die mir klar gemacht haben, dass die Menschen offen für Argumente sind und sich auch engagieren wollen. Diese Menschen sind der Grund, warum ich (immer noch) in der SPÖ bin. Ich habe einmal im Vorfeld eines Wahlkampfes einem führenden Genossen, der die größte „Hausbesuchsaktion aller Zeiten“ plante, von meinen Erlebnissen erzählt und ihm angeboten, meine Erfahrungen einzubringen. Er lehnte dankend ab und meinte: „Wir sagen unseren Leuten, sie sollen auf ein anderes Thema ausweichen.“ Natürlich hat er die Wahl mit Bomben und Granaten verloren. Indem die politische Klasse dieser Republik das Thema Asyl totschweigt bzw., wenn es gar nicht mehr anders geht, sich in symbolischen Alibiforderungen, wie der Einführung von Grenzkontrollen zu profilieren versucht, begeht sie einen fatalen Fehler. Hans Rauscher bezeichnete das im Standard völlig zu Recht als „ein Rezept für den politischen Untergang“. Sollte so wie bisher weiter dilettiert werden und sich dieses „Rücksichtnehmen auf die Rücksichtslosen“ fortsetzen, dann könnte die Stimmung im ganzen Land kippen. Und „dann wird dieser Staat nicht wiederzukennen sein.“

Traiskirchen ist kein Sommerthema. Es wird nicht möglich sein, im Herbst einfach in der politischen Tagesordnung weiter fortzufahren. Die Landtagswahlen in OÖ und in Wien werden – wenn sich nichts mehr grundlegend ändert – für ein politisches Erdbeben sorgen, dass die politischen Gewichte verschieben wird. Und nicht, weil die Menschen die FPÖ so sehr schätzen, vielmehr, weil sie ihrer Unzufriedenheit Ausdruck geben wollen. In diesem Zusammenhang spielt Traiskirchen als Metapher für die gescheiterte „Ausländerpolitik“ (die sie im Bewusstsein vieler Menschen immer noch ist) eine Schlüsselrolle. Traiskirchen steht für politische Handlungsunfähigkeit, für administrativen Dilettantismus und für mangelnde Sensibilität. Ja, und es zeigt einmal mehr, dass der Föderalismus die Republik nicht zusammenhält, vielmehr zu einem bedrohlichen Zentrifugalfaktor geworden ist.
Die 2. Republik ist in ihrem Endstadium angelangt. Begonnen hat dieser Prozess vor beinahe 30 Jahren beim Innsbrucker Parteitag der Freiheitlichen mit der putschartigen Inthronisierung Jörg Haiders. Seither ist das Land in einer Art Schockstarre. Die politischen Eliten sind seither wie gelähmt. Kaum mehr fähig zum gemeinsamen Handeln. Die Traiskirchner Republik, in der wir gegenwärtig leben, ist eine Art Übergangsstadium. Noch ist nicht entschieden, wohin die Reise geht. Bewegen wir uns in eine autoritäre Richtung so wie in Ungarn? Oder gelingt am Ende doch ein demokratischer Neuanfang. Ob das gelingt, hängt davon ab, wie die gegenwärtige Situation gelöst wird. Aussitzen lässt sich das nicht mehr. Also endlich aufwachen! Der Beschluss des Nationalrates ist ein erster Schritt. Möglicherweise kommt er zu spät. Es braucht eine offensive, auf die Einbindung der Bevölkerung ausgerichtete Strategie. Ja, wir werden mit viel mehr Flüchtlingen als bisher rechnen müssen, solange die Kriegsherde im Mittleren Osten nicht stabilisiert sind und Afrika unter den Folgen europäischer Handelspolitik leidet.
Das zu verschweigen oder vorzuheucheln, man könne einzelne Bundesländer von Flüchtlingen freihalten ist der Kern des Übels. Ebenso die permanente Unterstellung, es würde sich bei den Asylwerbern um „Wirtschaftsflüchtlinge“ oder Kriminelle handeln. Diese Darstellung widerspricht nicht nur diametral der Realität – sie entspricht auch dem Tatbestand der Volksverhetzung. Dieser aggressiven Hetze und bewussten Verdrehung muss mit aller Entschiedenheit und mit dem Einsatz der letzten noch verbliebenen Autorität entgegengetreten werden. Von ganz oben. Klar und deutlich. Nicht so wie bisher. Und die Verantwortlichen sollten sich vor allem über einen positiven Aspekt freuen, den sie nicht beabsichtigten: über die nicht abreißen wollende Welle zivilgesellschaftlichen Engagements. Zehntausende ÖsterreicherInnen sind seit Wochen auf den unterschiedlichsten Ebenen freiwillig tätig, um den Flüchtlingen zu Seite zu stehen, indem sie Nahrung und Kleidung zur Verfügung stellen, Wohnungen bereitstellen, Deutschunterricht anbieten oder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die meisten haben das Gefühl, dass ihr Engagement oft nur geduldet wird. Es gibt nicht wenige Fälle, wo dies sogar explizit unerwünscht ist. Gerade jetzt wäre es für die staatstragenden Parteien wichtig, auf diese Menschen zuzugehen. Weitaus wichtiger als das Schielen auf verantwortungslose Hetzer und Demagogen. Also auf die Rücksichtsvollen Rücksicht nehmen und nicht auf die Rücksichtslosen. Die Erkenntnis, dass es so viele Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich aktiv und mit Engagement für die Gemeinschaft einsetzen und Verantwortung übernehmen wollen, das müsste eigentlich alle Pessimisten aufrütteln und alle Politstrategen, denen bislang nur zynische Rezepte eingefallen sind, nachdenklich machen.
In den letzten vier Wochen haben sich die europäischen Staats-und Regierungschefs viermal und die Finanzminister der Eurogruppe sogar neunmal getroffen, um in nächtelangen Beratungen zu guter Letzt eine fragile Lösung für Griechenland zu vereinbaren. Die sozialen Folgen für Griechenland sind verheerend und vor allem hat die Glaubwürdigkeit des europäischen Projekts gelitten. Massiv. Für Europa waren es Wochen der optimalen Selbstbeschädigung. Recht viele solcher Gipfel wird die EU wohl nicht mehr aushalten. Viele Menschen wenden sich von Europa ab. Sie sagen mir, sie hätten genug von der EU, und so hätten sie sich ein gemeinsames Europa nicht vorgestellt. Quer durch die Reihen. Egal, ob sie im Gipfelbeschluss einen neokolonialen Eingriff in nationale Souveränität oder einen erfolgreichen Erpressungsversuch sehen. Europa wäre schwach, uneinig und undemokratisch. Die wenigsten glauben noch, dass es gelingen wird, die immer schwieriger werdende Lage des alten Kontinents in den Griff zu bekommen. Kriege an den Rändern, ein stetig steigender Migrationsdruck, Überalterung und ökonomischer Bedeutungsverlust machen viele verzagt. Immer mehr behaupten – ohne dafür logische Argumente zu haben – man könne dem nur durch Re-Nationalisierung begegnen. Seit dem Ausbruch der Finanzkrise kämpft Europa ums Überleben. Dabei geht es um viel mehr als um die gemeinsame Währung. Alles, was bisher geschah, war unzureichend und politisch falsch. Zumindest sehe ich das so. Man braucht ja bloß die europäische Entwicklung mit den USA zu vergleichen. Alle Zahlen sprechen gegen das europäische Austeritätsdogma. Doch darum geht es mir jetzt nicht. Also nicht zum x-ten Mal Tsipras gegen Merkel oder Varoufakis gegen Schäuble.
Ich möchte den Blick auf die Orte der Krisenbewältigung lenken. Am Ende stand das eigentlich Selbstverständliche: die Parlamente der Mitgliedsstaaten. Ohne deren Zustimmung, insbesondere der griechischen Abgeordneten wären alle Mühen vergeblich gewesen. Mit der wesentlichen Einschränkung, dass deren Zustimmung vom Diktat der Alternativlosigkeit geprägt war. Aber immerhin geschah dies in aller Öffentlichkeit. Ganz anders hingegen der Weg der Entscheidungsfindung. Dieser war nicht öffentlich. Was nicht heißt, dass die Öffentlichkeit nicht präsent gewesen ist. Sie wurde vorab, rundherum und vor allem anschließend ausführlich über das jeweilige Geschehen informiert. Die Konfliktparteien ließen die Medien wissen, wie sich die Dinge aus ihrer Sicht darstellten. Nicht immer objektiv und immer interessenbezogen. Manche erschlossen sich eigene Informationsquellen und meinten etwa, aus der Mimik Schäubles, über dessen wahre Absichten Bescheid zu wissen.
Hin und wieder drang nach draußen, dass es Nachdenkpausen gab, Drohungen ausgesprochen wurden oder jemand ins „Beichtstuhlverfahren“ gezwungen wurde. Keine Rolle für die Öffentlichkeit spielte allerdings, wer, wann und mit welcher Berechtigung etwas vorbrachte. Vielmehr als Argumente, zählte, wer am längsten durchhielt. Der letzte Gipfel dauerte 17 Stunden. Regierungschefs samt Entourage, deren Arbeitswoche normalerweise mit Terminen vollgestopft ist, verbringen in Krisenzeiten ihre Wochenenden im Brüsseler Ratsgebäude oder vergleichbaren Orten. Sie produzieren Ergebnisse, die unter einem enormen Zeit-und Erfolgsdruck stehen. Die Qualität solcher im Zustand von Ermüdung und Erschöpfung getroffener Entscheidungen ist oft mangelhaft. Dafür gibt es eindeutige Hinweise der sozialpsychologischen Forschung. Ganz verständlich, dass es immer wieder Nachbesserungsbedarf gibt und oft ein endlich zustande gekommener Kompromiss bereits einen nächsten Gipfel notwendig macht. Ein einziges Mal schien es anders zu gehen. Zumindest gab es diesen Augenblick, als Alexis Tsipras, der spontanen Einladung des Europäischen Parlaments folgte, am 8.Juli, an der Griechenland-Debatte teilzunehmen. Großes Theater. Beifall und Buhrufe hielten sich die Waage, als der griechische Präsident eintraf. Mit dabei auch Jean-Claude Juncker und der Präsident des Rates Donald Tusk. Die Debatte, die fast drei Stunden dauerte war heftig und intensiv, mitunter untergriffig. Es war ein historisches Ereignis. Darin waren sich alle, die dabei waren, einig.
Tsipras konnte man die Strapazen der letzten Wochen deutlich ansehen. Er folgte mit großem Interesse der Debatte. Ich konnte ihn aus nächster Nähe beobachten, wie er sich ärgerte und wie er sich in Bann nehmen ließ, etwa bei Guy Verhofstadts Rede. Bei seiner Antwort auf die Debattenbeiträge der Abgeordneten wirkte er nicht mehr müde. Vielen wird in Erinnerung bleiben, was er zu Beginn sagte: „Ich denke, diese Sitzung hätte schon vor geraumer Zeit erfolgen müssen. Weil die Diskussion, die wir heute führen, nicht nur die Zukunft Griechenlands betrifft, sie betrifft die Zukunft der Eurozone. Und diese Diskussion darf wirklich nicht in Sälen mit geschlossenen Türen durchgeführt werden.“ Recht hat er. Weil es an den Beginn der Griechenlandkrise erinnert. Damals glaubte eine unter innenpolitischem Druck stehende Angela Merkel, sie müsste den Rettungsschirm samt dazugehörendem Fiskalpakt am Europäischen Parlament vorbei konzipieren. Sie bediente sich der intergouvernementalen Methode. In den europäischen Verträgen ist dies ausdrücklich nur als Ausnahmemechanismus vorgesehen. Das Europäische Parlament hat sich daher damals auch klar dagegen ausgesprochen. Wir haben befürchtet, dass auf diese Weise über die Hintertür ein „neues Modell europäischen Regierens“ eingeführt wird. Dieses Modell intergouvernementalen Regierens, forciert vom damaligen Leiter der europapolitischen Abteilung des deutschen Bundeskanzleramtes Nikolaus Meyer-Landrut ist grandios gescheitert. Es hat schlechte Ergebnisse produziert und hat die Menschen wütend auf Europa gemacht. Gleichzeitig hat es das Parlament gehindert, seiner demokratischen Verpflichtung nachzukommen. Hinter verschlossenen Türen kann und darf man nicht über die Zukunft Europas entscheiden. Solche weitreichenden Entscheidungen müssen die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen können. Das ist bei Griechenland und bei der sogenannten Eurorettung nicht passiert. Grundlegendes wurde beschlossen.
Niemand weiß, wie die Entscheidungen tatsächlich zustande gekommen sind. Wir wissen, wann sie zustande kamen. Immer nach Mitternacht. Überlastete Regierungschefs oder Fachminister, deren Positionen von Beamten, von Think-Tanks und wissenschaftlichen Stäben vorbereitet waren, von sogenannten Sherpas vorverhandelt wurden, entschieden in wechselnder Zusammensetzung und kommunizierten die Resultate dann vorrangig mit den nationalen Medien. Nicht die sachlichen Zusammenhänge standen im Vordergrund, sondern die entscheidende Frage, wer sich durchgesetzt hat.
So zerstört man Europa und es ist nicht zufällig, dass just zu dem Zeitpunkt, wo dieser intergouvernementale Exzess so richtig losging, Uwe Corsepius, ein Deutscher das Generalsekretariat des Europäischen Rates übernahm. Dieser folgte übrigens dem als deutscher Botschafter nach Paris wechselnden Meyer-Landrut. Alles Dinge, die sehr relevant sind und über die die Menschen Bescheid wissen sollten. In einem Parlament, im Besonderen im Europäischen Parlament stehen solche Vorgänge im Rampenlicht einer europäischen Öffentlichkeit. Entscheidungen, die so fundamental die Zukunft Europas betreffen, gehören in diese Öffentlichkeit. Deshalb ist es höchste Zeit, dass sich die deutsche Bundeskanzlerin und ihr Bundesfinanzminister endlich einmal ins Europäische Parlament wagen und sich der längst überfälligen Debatte stellen. Hier können sie erklären, was sie dazu veranlasst hat, ihre germanozentrische Sicht der Dinge der gesamten Union aufzuzwingen. Hier würden sie auch die Sorgen vieler Abgeordneter zur Kenntnis nehmen müssen, dass eine Fortführung der ideologisch motivierten Sparpolitik das gesamte europäische Projekt gefährden würde. Und wenn diese Antworten nicht befriedigend ausfallen, dann müssten sie mit einem negativen Votum der Vertretung der europäischen Bürgerinnen und Bürger rechnen. Wie das in Demokratien üblich ist.
Titelbild: dpa | Like Joe auf Facebook | Folge Joe auf Twitter
Ich war noch nie in Srebrenica. Aber ich war in Gorazde. Beides sind Städte in Ostbosnien, an der Drina gelegen, beide Städte waren Gegenstand brutaler Belagerung während des Jugoslawienkrieges und standen damals unter dem halbherzigen Schutz der Vereinten Nationen. Ich war nur kurz in Gorazde und traf mich mit den politisch Verantwortlichen, in einem Lokal direkt an der Drina. Es waren Männer, stolze Männer.
Das Verbrechen von Srebrenica
In Srebrenica gibt es keine stolzen Männer. Srebrenica ist der Ort eines der grauenvollsten Verbrechen im heutigen Europa. 8000 seiner Männer wurden systematisch auf bestialische Weise gemordet. Genozid nennt das Völkerrecht ein solches Verbrechen, dessen Tatbestand darin besteht, „eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören.“
Genau das geschah in den Julitagen des Jahres 1995 in Srebrenica. Mitten in Europa, vor den Augen der ganzen Welt. Deren Repräsentanten, in diesem Fall UN – Friedenstruppen aus den Niederlanden, sahen tatenlos zu, ja, ließen sich zu opportunistischen Komplizen degradieren. Die Männer von Srebrenica waren den Kräften wehrlos ausgeliefert, die sich zum Ziel gesetzt hatten, diese Region ethnisch zu säubern. Mitten in Europa. Dieser nationalistische Wahn hatte sich seit Generationen aufgebaut, basierte auf Vorurteilen, Neid und Minderwertigkeitskomplexen, immer präsent in der Region. Zumeist blieb dieser Wahn auf eine kleine Gruppe von versponnenen Abenteurern und hirnlosen Maulhelden beschränkt. Wie der berühmte Geist in der Flasche. Immer dann, wenn es kriselt, dann greift man nach der Flasche.
So auch zu Beginn der 1990-er Jahre, als Jugoslawien kollabierte. Plötzlich zählte nur mehr das Negative. Schuld waren immer die anderen. Menschen, die gute Nachbarn waren, wurden plötzlich zu Feinden. Menschen, die diese Gegend seit Jahrhunderten gemeinsam bewohnt hatten, wurden drangsaliert, ihrer Würde beraubt und erniedrigt. Sie wurden vertrieben, vergewaltigt, niedergemetzelt. Man wollte sie auslöschen, ein für alle mal. Unter der Führung, eines sich auf seine verborgene historische Größe rückbesinnenden Serbien sollte Jugoslawien aus der Krise heraussteigen wie der Phönix aus der Asche. Mit der Kraft aus der Vergangenheit hinein in eine neue Zukunft! – Auch das ist Europa.
In unserem Fall reichte die Vergangenheit zurück bis ins Jahr 1389. Zur Mutter aller Schlachten und allen Unheils, zur Schlacht am Amselfeld. 600 Jahre sind eine Ewigkeit. 600 Jahre, das sind 20 bis 30 Generationen, die diese Geschichte unentwegt fort tradiert und weiter gesponnen haben. Das prägt sich ein in die Seele eines Volkes. Wer auf einem solchen Klavier spielt, wie das Milosevic mit seiner berühmten Rede getan hat, der muss mit den Konsequenzen rechnen. Und es gilt auch: Wer sich selbst erhöht, der erniedrigt andere. Nationalistischer Größenwahn lässt sich nicht dosieren. So wie der Geist aus der Flasche. Einmal entwichen kann ihn keine Macht der Erde wieder in die Flasche zwingen. Seine Wirkung ist hochtoxisch, er vernebelt die Gehirne, macht hemmungslos und bricht alle Tabus. So geschehen in Sarajevo, Prijedor, Omarska, Visegrad und eben Srebrenica. Eine Flugstunde bzw. eine Tagesreise von Österreich entfernt. So nah und dennoch – für die Mehrzahl der Menschen hierzulande – weit weg.
Der Bosnienkrieg und als seine ultimative Übersteigerung der Genozid von Srebrenica hinterließen eine offene Wunde, die noch lange nicht abgeheilt ist. Sie zeigen auf, dass wir uns nicht selbstzufrieden damit brüsten können, Europa hätte seine Lektionen aus der Katastrophe des von den Nazis angezettelten großen Krieges gelernt. Srebrenica ist eine Stätte ,an der niemand stolz sein kann. Anders als in Orten wie Sarajevo, wo man unter vielen Opfern der brutalen Übermacht standhielt, oder eben Gorazde. Srebrenica ist eine Stätte der Schande, eine Stätte der Schmach und der Niedertracht. Srebrenica macht traurig und betroffen. Es macht hilflos, das Geschehene in Worte zu fassen. Zum Glück ist die menschliche Sprache dazu nicht fähig. Es zeigt aber auch unsere ganze Hilflosigkeit, das Unfassbare nicht verhindert zu haben oder es ungeschehen machen zu können. Angesichts der Tragik der Vorgänge reicht es freilich nicht aus, den Hinterbliebenen Mitleid entgegen zu bringen oder ihnen die Versicherung unseres tiefen und aufrichtigen Beileids abzustatten. Das ist viel zu passiv gewollt.
Srebrenica muss uns wütend machen. Zornig.
In so einer Situation kann der Zorn – der unter alltäglichen Umständen ein schlechter Ratgeber ist – ein heiliger Zorn sein. Niemals zu vergessen – das sind wir den Opfern und ihren Hinterbliebenen schuldig. Die Täter wollten alles, was vom muslimischen Srebrenica zeugen könnte: die Menschen, ihre Geschichte, ja das künftige Erinnern ein für alle mal zum Verschwinden bringen. Genauso wie es im Übrigen die Nazis hielten. In Treblinka, Sobibor oder Hartheim, wo sie alle Spuren tilgten, die an ihr verbrecherisches Tun erinnert hätten. Keine Spuren sollten übrig bleiben vom Völkermord in Srebrenica. Die Täter verscharrten ihre Opfer und unternahmen allerlei Täuschungsmanöver, um spätere Identifizierungen unmöglich zu machen. Selbst als Tote sollten sie nicht mehr existieren.
Es ist eine nur den Menschen eigene Verhaltensweise, die Toten würdevoll zu bestatten. Dies zu verweigern ist eine zutiefst unmenschliche, ja nichtmenschliche Tat. Eine der ältesten Tragödien Europas handelt davon: Antigone, die Tochter des Ödipus. Diese fühlte sich verpflichtet, auch unter Androhung der Todesstrafe für eine würdevolle Bestattung ihres Bruders zu sorgen. Sie widersetzte sich dem königlichen Gesetz und bezahlte dies mit dem eigenen Leben. Bertolt Brecht setzte die antike Tragödie in Bezug zu den Nazi Verbrechen. Was er Antigone über die Jahrhunderte zurück zurief, das gilt ebenso für die Frauen von Srebrenica: „ Noch je vergaßest Du Schimpf und über die Untat wuchs ihnen kein Gras.“
Menschen, die Srebrenica vergessen lassen wollen, die die Geschehnisse leugnen oder verharmlosen, solche Menschen tragen dazu bei, dass sich derartiges wiederholt, ja, solche Menschen leisten künftigen Verbrechen Vorschub. Das Leugnen der Verbrechen von Srebrenica ist vielmehr selbst ein Verbrechen. So wie das Leugnen des Holocaust.
Niemals vergessen – dieses Motto des Antifaschismus trifft gerade in diesem Fall zu.
Wie sollte man das jemals vergessen können. Ich erinnere mich noch gut an eine Pressekonferenz der oberösterreichischen Volkshilfe, wenige Tage nach den schrecklichen Vorkommnissen. Als Gäste hatten wir Frauen, die soeben dem Grauen entkommen waren, weil sie sich über die Berge bis nach Tuzla durchschlagen konnten.
Ich erinnere mich an die Gefühle der Ohnmacht und des Zornes, die in mir hochkamen. Vor allem einen Tag später, als ich feststellen musste, dass die Medien kaum Notiz nahmen. Auf meine Vorhaltungen hin erklärte mir ein befreundeter Journalist, ich müsste doch einsehen, dass österreichische Medien die Verpflichtung hätten, nicht einseitig Partei zu ergreifen. Aber: das Verbrechen des Genozids erlaubt keine Äquidistanz. Wer die Schuldigen nicht benennt, Unrecht nicht als solches bezeichnet, der kann keinen Schlussstrich unter die Vergangenheit setzen. Und damit gibt es auch keine Zukunft.
Nicht zu vergessen, bedeutet freilich nicht, daraus die Berechtigung ableiten zu können, das „Tätervolk“ hassen zu dürfen. Man kann Individuen hassen, aber niemals ein Volk.
Antigone, die große Frauengestalt aus der Antike, sprach, als sie bereits ihren Tod vor Augen hatte, jene seherischen Worte, die ein politisches Vermächtnis für Europa darstellen: „Nicht (mit) zu hassen, (mit) zu lieben sind wir geworden!“ Solche Größe ist nicht immer möglich und bedarf eines stetigen Bemühens.
Die Drina, dieser Schicksalsfluss Europas, ist Zeugnis davon, dass solches immer wieder gelingt. Ivo Andric, der heute keineswegs Unbestrittene, hat in seinem mit dem Nobelpreis gewürdigten Roman „Die Brücke über die Drina“ beschrieben, wie konstitutiv für die Stadt Visegrad das Zusammenleben der verschiedenen Ethnien und gleichzeitig fragil dieses Gebilde war. Er hat uns eine zentrale Erkenntnis vermittelt, ohne die Europa nicht existieren kann:
„Von allem, was der Mensch baut und aufbaut, gibt es nichts Besseres und Wertvolleres als Brücken.“
Europa als Bewältigung vergangenen Schreckens
Europa ist vor allem eine Baustelle. Der ständige Versuch, den Einsturz und das Zusammenbrechen zu verhindern, indem man Provisorien einzieht, Notlösungen vornimmt und zuweilen kühne Konstruktionen zulässt. Europa ist das stetige Bemühen, überall dort Brücken zu bauen, wo sich unüberwindbare Gräben auftun.
Brücken werden zumeist aus materiellen Überlegungen errichtet, um Handel zu treiben, um miteinander in Kontakt zu treten. Einmal errichtet werden sie bald zur Selbstverständlichkeit. Erst wenn sie zerstört sind, merkt man, wie wichtig sie sind.
Wie die Brücke von Mostar, die Brücke über die Drina in Vysegrad oder die Donaubrücke in Novi Sad.
Europa ist geworden. Es wurde nicht auf dem Reißbrett konzipiert. Es ist gewachsen aus der Einsicht der Menschen, etwas falsch gemacht zu haben. Das zugrundeliegende Motiv: es besser zu machen und die Selbstzerfleischung nicht mehr zuzulassen.
Es gab viele Anläufe zu einem gemeinsamen Europa. Zunächst blieb dies auf wenige Weitsichtige beschränkt. Die Mehrheit erlag nur allzu leicht immer wieder dem berauschenden Gift des Nationalismus. Von Niederlage zu Niederlage freilich schwoll das Lager der Einsichtigen an. Die große Katastrophe des Zweiten Weltkriegs erlaubte schließlich einen Paradigmenwechsel, einen Neubeginn.
Am Anfang des europäischen Projekts standen Erschöpfung und Müdigkeit und das Gefühl, noch einmal davongekommen zu sein. Man könnte es auch als ein Gefühl der Erleichterung beschreiben. Endlich war es vorbei, das Grauen, dem man sich nur schwer entziehen konnte, und dem man mehr oder minder ausgeliefert gewesen ist.
Es waren keine hochmögenden Visionen, die die europäischen Staatsmänner der Nachkriegsjahre antrieben, vielmehr schierer Überlebenstrieb. Nicht ideologisch verbrämte Mythen, sondern Pragmatismus stand am Beginn der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich.
Carlo Schmid, der große deutsche Sozialdemokrat analysierte den Neubeginn in den Beziehungen der beiden „Erbfeinde“, ohne den der europäische Einigungsprozess nicht möglich gewesen wäre, einmal folgendermaßen:
„Dieses Sich-aneinander -Wagen setzt voraus, daß man bereit ist, den anderen so zu wollen, wie er ist, nicht wie man ihn haben möchte.“ Es wäre gleichsam ein „Glücksfall“, wie eben im historischen Falle Deutschlands und Frankreichs, wenn sich dieser Moment „auf dem Nullpunkt der Erwartung“ ereigne.
Europa – und darin liegt seine Stärke und Schwäche zugleich – ist eine nüchterne, eine trockene Angelegenheit. Europa- das bedeutet nicht Liebe auf den ersten Blick.
Europa ist nicht sexy. Sofern wir Gefühle für Europa haben, haftet ihnen nichts Erotisches an, so wie das für den überall am Kontinent grassierenden Patriotismus zutrifft. Eher ein Gefühl von Sicherheit oder vielleicht Dankbarkeit. Und eher Zuversicht als Gefühl. Die europäische Integration war keine Liebesheirat, vielmehr eine wohlüberlegte, an materiellen Vorteilen orientierte Ereigniskette.
Wir wissen, dass Vernunftehen mitunter häufiger von Bestand sind, als von der Aufwallung von Gefühlen getriebene Liebesheiraten.
Der europäische Prozess entwickelte sich parallel, auf zwei unterschiedlichen Pfaden.
Zunächst in eine politische Richtung: Inspiriert von Winston Churchills berühmter Züricher Rede von 1946, in der er die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich forderte und dafür plädierte, nicht „Hass“ und „Rache“ fortzuschleppen und die Europäer leidenschaftlich aufforderte: „Lasst Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Freiheit walten.“ Die Schaffung der von ihm propagierten Vereinigten Staaten Europas, für die er nur ein kleines Zeitfenster sah, scheiterte, nicht zuletzt an britischen Bedenken. Der Europarat, dessen parlamentarische Versammlung regelmäßig in Straßburg tagt, ist der bescheidene Rest, der von diesen politischen Träumen übrig geblieben ist.
Der zweite Pfad setzte bei den materiellen Interessen der Menschen an. Sie sollten ungehindert Handel treiben können, ihre Industriepolitik und ihre Atompolitik gemeinsam ausrichten. Gekrönt wurde dieser Prozess mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahr 1957. Europa wurde zu einer Wirtschaftsgemeinschaft.
Das dahinterliegende Kalkül war einfach und auch richtig. Auf die wirtschaftliche Einigung würde automatisch die Einsicht folgen, sich auch politisch enger zusammen zu schließen. Wenn Menschen miteinander Handel treiben, möglichst ungehindert durch Grenzen und Zölle, dann kommen sie sich näher. Menschen, die miteinander in geschäftlichem Kontakt stehen, entwickeln wechselseitiges Vertrauen. Dieses ist ihre Geschäftsgrundlage. Menschen, die notorisch Zwietracht säen, wie es das Naturell von Nationalisten ist, solche Menschen werden als geschäftsschädigend empfunden und alsbald isoliert.
So ist das nach 1945 passiert. Ich erinnere mich noch gut an meine eigene Kindheit, an die Erzählungen meines Großvaters, eines ganz lieben Menschen, der noch die Schlachten am Isonzo erlebt hatte. Ich erinnere mich, wie wir Kinder abfällig von den Italienern als „Katzelmachern“ und „Spaghettifressern“ sprachen. Wenn ich das heute meinen mit Pizza und Pasta groß gewordenen Kindern erzähle, dann verstehen sie mich nicht. Das ist Europa
Its the economy!
So hätte es auch in Bosnien passieren können, so wird es vielleicht passieren. Ich erinnere mich noch gut, als ich zum ersten Mal in Brcko war. Gleich nach dem Krieg.
Noch nie in meinen Leben habe ich ein solches Ausmaß an Zerstörung gesehen – vom Kugelhagel zersiebte Häuser und dem Boden flachgemachte Siedlungen. Und dennoch gab es etwas Überraschendes, das sich ebenfalls in meine Erinnerung eingeprägt hat: Arizona-Market. Zuweilen der größte Markt auf dem Balkan. Hier fand man alles, was man kaufen wollte, und hier fanden sich alle ein. Auch Menschen, die wenige Monate vorher noch gegeneinander gekämpft hatten, handelten miteinander. „Kaufen statt kämpfen“ übertitelte 1996 die WELT eine Reportage über Brcko.
Mehr als 15 Jahre später ist Brcko, trotz vieler negativen Seiten, die es auch aufweist, eine der wenigen Orte, wo Bosnien funktioniert, wo die meisten der Vertriebenen zurückgekehrt sind und das multiethnische Zusammenleben möglich ist.
Ja, wirtschaftliche Vernunft ist eine wichtige Basis für menschliches Zusammenleben. It’s the economy!
Das europäische Projekt ist auf dieser Grundlage zustande gekommen. Und es ist ein Erfolgsprojekt, allen Unkenrufen zum Trotz. Es war ökonomisches Denken, also die durchaus richtige Erkenntnis, dass die Menschen nur dann zu einem politischen Projekt JA sagen, wenn sie etwas davon haben. Wenn jede/r etwas davon hat. Wenn es am Ende dazu führt, dass alle das Gefühl haben, nicht übervorteilt zu werden. So wie am Beispiel von Arizona/Brcko.
Wirtschaftlicher Erfolg macht aber oft übermütig, führt zur Vernachlässigung nichtökonomischer Aspekte. Wenn die Ökonomie nur mehr sich selbst genüge ist, dann kommt es zum Marktversagen. Und es gibt Profiteure auf Kosten der Allgemeinheit, vor allem aber Menschen, die zu Schaden kommen, weil sie übervorteilt werden. Gesellschaftliche Ungleichheit ist die Kehrseite der Marktwirtschaft. Sie tritt vor allem dann auf, wenn die Marktwirtschaft ohne das Adjektiv „sozial“ auszukommen glaubt und wenn sie ungehemmt durch staatliche Eingriffe der bloßen Profitmaximierung dient.
Die Gier ist mittlerweile zur universellen Triebfeder in Europa geworden. Zumindest treibt sie die spekulativ agierenden Finanzmärkte an. Mit atemberaubender Geschwindigkeit werden kurzfristige Vorteile gesucht. Dieser Geist hat die Mehrheit der Menschen erfasst. Was dem einem seine Bonuszahlung ist, sind den anderen überall lockende Schnäppchen, privilegierte Zugänge zu irgendwelchen Programmen, die meisten möchten premium oder executive sein.
Es herrscht eine hektische Drängelei in dieser selbsterklärten Hochleistungsgesellschaft.
Europa ähnelt einer Autokolonne, in der jeder seinen eigenen Vorteil suchend, den anderen in riskanten Manövern zu überholen versucht, ohne dadurch freilich früher am Ziel zu sein. Die Gier ist allgegenwärtig.
Viele Menschen spüren das. Die Europaskepsis greift um sich. Europa wird von vielen nur mehr als ein Projekt der ökonomischen Eliten gesehen, denen man überdies keine wirkliche Problemlösungskompetenz zubilligt. In der Tat ist es bislang nicht gelungen, den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Vorteile in Aussicht zu stellen. Es kommt nichts, genauer, es kommt zu wenig für die Menschen heraus.
Ein soziales Europa! Das ist ein ständig wiederkehrender Slogan der linken und progressiven Parteien bei Wahlen zum Europäischen Parlament. Sobald die Wahlkämpfe vorüber sind, gerät diese Forderung gleich wieder in den Orkus des Vergessens, um dann bei den politischen Sonntagsreden wieder hervorgeholt zu werden.
Dann beschwört man mit sanften Tönen das europäische Sozialmodell. Europa wäre ein Kontinent des sozialen Ausgleichs und der Sorge um die Mitmenschen. Sobald es allerdings um Reformen geht, werden die USA zum Vorbild erklärt.
Europa hat es nicht geschafft, die durchaus gelungene wirtschaftliche Integration sozial abzufedern. Europa, das sind die Märkte: Deregulierung, Privatisierung, Wettbewerb lautet deren Mantra.
Wenn die Märkte diktieren
Dieser Mangel hat weitreichende Konsequenzen. Zum einen, weil ein vorrangig auf die Wirtschaft ausgerichtetes Europa seine Bürgerinnen und Bürger enttäuschen muss. Denn niemand kann auf Dauer eine Politik durchsetzen, die von der breiten Masse Opfer und Verzicht fordert, ohne dass etwas Erkennbares zurückkommt. Zum anderen begünstigt eine solche Politik die Besitzenden und verstärkt die soziale Ungleichheit. Je stärker die soziale Ungleichheit ausgeprägt ist, umso mehr geraten die europäischen Gesellschaften aus dem Gleichgewicht. Wirtschaftlich, sozial und politisch.
Wachsende Ungleichheit und die damit einhergehende Verunsicherung ist der Nährboden für allerlei Populismus.
Jedes Sparpaket, jede Haushaltskürzung vergrößert das Potential, auf das die Demagogen rücksichtslos zugreifen können. Solange die Politik der demokratischen Parteien nur Opfer und Belastungen verlangt und nicht vermitteln kann, dass diese nicht umsonst waren, solange wird diese Gerechtigkeitslücke ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit bei den breiten Massen hinterlassen.
In allen Mitgliedsstaaten ist die populistische Rechte auf dem Vormarsch: nicht nur in Ungarn, schon seit einigen Jahren in Frankreich und Italien oder in Österreich. Auch in Staaten mit liberaler Tradition, wie den Niederlanden oder im skandinavischen Norden.
Das nationalistische Gift, von dem man glaubte, es würde niemals mehr eingesetzt, wird wieder aus dem Medikamentenschrank geholt. Wir wissen, wohin das führt.
Aber wir werden das nicht verhindern können, wenn wir bloß auf diese historischen Zusammenhänge verweisen. Dies ist redlich und ehrenhaft, dies ist wichtig, weil wir die Fehler aus der Geschichte nicht wiederholen wollen.
Aber es reicht nicht aus. Vielmehr müssen wir dem Populismus den Nährboden entziehen, in dem wir die Gerechtigkeitslücken schließen. Wir brauchen ein soziales Europa, das diesen Namen auch verdient.
Europa ist die einzige Chance, die gewaltigen Probleme, vor denen wir stehen, in den Griff zu bekommen. Wer glaubt, dass sich europäische Nationalstaaten in einer komplexen und riskanten Welt, in der das Machtzentrum im Pazifischen Raum liegt, so ohne weiteres Gehör verschaffen können, der irrt. Nicht einmal Deutschland ist dazu in der Lage.
Wir brauchen Europa. Ansonsten droht nicht nur ein Bedeutungsverlust des Kontinents von historischem Ausmaß, sondern damit einhergehend auch ein deutlich spürbarer Wohlstandsverlust. Letztlich würde dies auch den so mühsam gesicherten Frieden auf unserem Kontinent in Gefahr bringen.
Wir brauchen allerdings ein anderes Europa. Ein Europa das bereit ist, sich zu verändern. Nicht nur in sozialer Hinsicht! Europa muss vor allem demokratischer werden.
Jene weitsichtigen Menschen, die nach dem 2. Weltkrieg die deutsch-französische Freundschaft begründeten, hatten dabei sicherlich nicht die nervös–hektische Kabinettspolitik von Merkel und Sarkozy im Sinn. „Merkozy“ das ist nicht Europa, zumindest nicht jenes, das wir brauchen. Der deutsche Sonderweg, der die deutsch-französische Achse abgelöst hat, ist ein Irrweg.
Wir brauchen keine Einzelkämpfer, die auf Kosten der Kleinen und Schwachen ihre Ellbogen ausfahren. Wir brauchen mehr Gemeinschaftlichkeit. Wir müssen die gemeinsamen Institutionen, vor allem das Europäische Parlament, stärken.
Es gibt heute viel Europaskepsis, leider mittlerweile auch in Deutschland. Das ist die unerfreuliche Seite. Es gibt aber auch viele Menschen, gerade junge, die mehr denn je von Europa überzeugt sind. Wenn es uns gelingt – und dafür sehe ich gute Vorzeichen – das Gemeinschaftliche zu stärken, dann werden wir auch die großen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, lösen.
Jugoslawien zum zweiten Mal?
Gelingt uns dies nicht, dann droht uns ein Schicksal wie das Jugoslawiens. Eine an sich richtige Idee, die am Unvermögen seiner damaligen Staatsführung zu demokratischen Reform scheiterte. Die Parallelen zur gegenwärtigen EU sind vorhanden und sollten bei uns die Alarmglocken schrillen lassen.
Ich erinnere mich noch genau an Gespräche mit Menschen aus Jugoslawien, Ende der 1980-er Jahre, die vehement beklagten, dass sie den „Süden“ auf ihre Kosten „mitfüttern“ müssten. Der Süden, das waren immer die anderen. Für die Serben das Kosovo, für die Kroaten das Kosovo und Serbien, für die Slowenen ganz Restjugoslawien. Und dann gab es noch Bosnien, das sich Serbien und Kroatien am liebsten aufteilen wollten, hätte es da nicht die Muslime, die man auch Bosniaken nannte, gegeben.
Das Misstrauen war allgegenwärtig, und vor allem einer Staatsführung geschuldet, die nicht mehr in der Lage war, das Gemeinsame sichtbar zu machen und die Zentrifugalkräfte zu beherrschen.
Ich erinnere mich daran, wie schnell und leichtfertig man, gerade mit westlicher Unterstützung begann, dazu überzugehen, das Heil in der Zerschlagung Jugoslawiens zu suchen. Dieser Glaube war naiv und gefährlich. Die nationalen Gefühle, angefacht von den jeweiligen nationalen Regierungen, entfalteten sich überschwänglich, hielten vor nichts zurück und führten zum Bürgerkrieg, zu grausamen ethnischen Säuberungen und zum Völkermord.
Der Nationalismus hat das ehemalige Jugoslawien nachhaltig verändert und um Jahrzehnte zurückgeworfen. Eine ganze Generation wird nötig sein, um wieder Anschluss an die europäische Entwicklung zu finden. Der gewaltsame Tod von mehr als 100.000 Menschen, die Folgen der Gewaltexzesse, Massenvergewaltigungen, der Vertreibung und Flucht werden noch lange in den Seelen der Menschen ihre Ablagerungen hinterlassen.
Und das sei zumindest in den Raum gestellt: Regt sich nicht auch gegenwärtig wieder überall in Europa der Nationalismus und wird zum dominanten innenpolitischen Kalkül?
Exakt nach demselben Muster wie der Selbstzerstörungsprozess Jugoslawiens vor einer Generation?
Wieder sind es regionale Ungleichgewichte, die den Nationalismus entfachen. Man braucht nur den Menschen zuzuhören: Die faulen Griechen, die auf unsere Kosten leben, die Südeuropäer im Generellen. Wie zu Zeiten unserer Großeltern: Nur keinem Italiener trauen, schon gar nicht, wenn er der Chef der Europäischen Zentralbank ist. Vielleicht übertreibe ich, aber mitunter sollte man hellhörig sein.
An diese historischen Parallelen sollten denken, wenn wir uns der damaligen Opfer, der Frauen und Männer aus Srebrenica erinnern.
PS: Ich habe diese Zeilen im Jänner 2012 geschrieben. Sie dienten als Basis für eine Rede beim Politischen Aschermittwoch der Bayerischen Arbeiterwohlfahrt. Mehr als drei Jahre sind seither vergangen. Bosnien ist auf dem Weg, endgültig zu einem „failed state“ zu werden. Dem Erweiterungsprozess ist die Dynamik abhanden gekommen – besonders am Balkan. Die Europamüdigkeit hat nicht abgenommen, vielmehr breitet sich Unsicherheit aus, die immer häufiger in Wut und Zorn umschlägt. Vielleicht sind die Ereignisse in und um Griechenland nur das Vorspiel zu einer viel größeren Tragödie von gesamteuropäischen Ausmass. Ich wehre mich dagegen, diesen Gedanken zuzulassen. Aber ich fürchte mich davor, dass aus EU-rope in nicht allzu ferner Zukunft YU-rope werden könnte. Ein YU-rope Szenario, das wäre die Katastrophe des 21.Jahrhunderts, vergleichbar dem was der 1.Weltkrieg für das 20.Jahrhundert war. Wie müssen auf der Hut sein. Die Auflösung Jugoslawiens geschah ja auch nicht über Nacht und die Staatsmänner Europas schlafwandelten bekanntlich buchstäblich in den Ersten Weltkrieg.