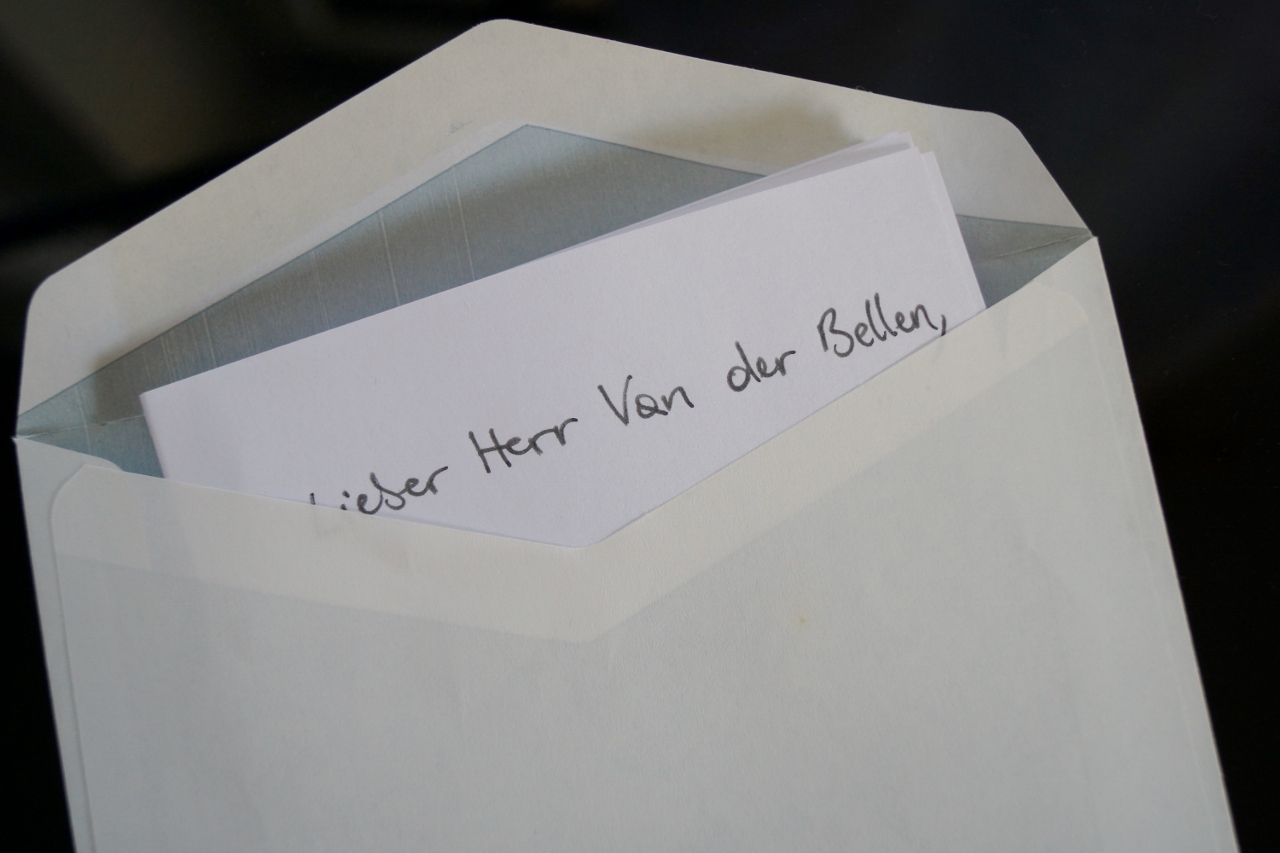Irgendwo über dem Atlantik. Ich habe die „Moving Map“ eingeschaltet. Landkarten haben mich schon als Kind interessiert, vor allem die Ozeane. Die ganze Zeit irritiert mich ein Punkt auf der Karte: Charlie-Gibbs Fracture Zone. Er verweist auf die tektonische Bruchzone unter dem Atlantik. Langsam, ganz langsam entfernen sich die amerikanische und die eurasische Platte voneinander. 2,5 cm pro Jahr.
Ich bin am Weg nach Kanada, gemeinsam mit Kollegen aus dem EU-Parlament. Wir wollen uns mit der dortigen Migrationspolitik vertraut machen. In Zeiten von Trump ist es wichtig, die transatlantischen Beziehungen im Auge zu behalten. Irgendwie kriege ich die Befürchtung nicht los, dass sich die beiden Kontinente mit wachsender Geschwindigkeit voneinander entfernen. Ich komme mit der Flugbegleiterin ins Gespräch. Ihr Deutsch ist eigenartig. Klingt zwar muttersprachlich, aber oft fehlt es an den entsprechenden Vokabeln. Ihre Mutter kam aus Deutschland. Sie freue sich ihre Muttersprache im Gespräch mit mir zu „improven“. Sie sagt es wirklich so. Sie ist stolze Kanadierin und stolz auf ihre deutsche Herkunft. Womit sie nicht zurechtkäme wäre dieser deutsche Karneval. Das fände sie überhaupt nicht lustig. Ob man dafür den Ausdruck „gekunstelt“ verwenden könne. Ich bejahe ihre Frage. Sie meint, dass ihre Mutter eigentlich aus Polen käme, aus Schlesien. Sie hätte Eichholzer geheißen. Wir reden über das großartige Breslau und darüber was der Unterschied zwischen Eichenholz und Weidenholz wäre. Und dass Deutsch als Muttersprache zu haben nicht bedeute, Deutsche(r) zu sein.
Im Multi-Kulti Parlament
Bei allen Menschen, mit denen ich fortan in Kontakt komme, geht es um deren Herkunft. Ungefragt erfährt man vom jeweiligen Gegenüber, ob sie/er im Land geboren wurde oder woher die Eltern und Großeltern kamen. Die meisten Abgeordneten, mit denen wir in Ottawa zusammentreffen, haben ihre Wurzeln außerhalb Kanadas. Der Kollege neben mir stammt aus dem Libanon, die Kollegin gegenüber aus Hongkong. Rund um den Tisch versammelt, Menschen aus Polen, Italien oder Kambodscha, ein deutschstämmiger Jude. Und eine Abgeordnete ukrainisch- mexikanischer Abstammung, die mit Stolz erzählt, in ihrem Wahlkreis gäbe es viele Portugiesen, die ihr besonderes ans Herz gewachsen wären. Ein älterer Kollege von der Konservativen Partei meint, er würde sich da direkt exotisch ausnehmen, da er lediglich irische Eltern aufweisen könne. Ich bin mir sicher, dass es weltweit kein Parlament mit einem derart hohen Anteil von Abgeordneten mit migrantischem Hintergrund gibt. Das spiegelt die gesellschaftliche Realität des Landes wider. Von woanders zu kommen, anders auszusehen das ist hier kein Nachteil. Im Gegenteil: „Diversity makes Canada great“. Das konnte ich – als Kontrapunkt zu Trump – immer wieder hören. Den Prozess der Nationswerdung Kanadas hätte es ohne dieses leidenschaftliche Bekenntnis zur Multikulturalität niemals gegeben. Und Kanada würde auch nicht zu den wohlhabendsten Ländern der Welt gehören. Das multikulturelle Toronto boomt, weil es Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Kanadierin oder Kanadier ist man, wenn man in diesem Land lebt und arbeitet. Eine Kopftuchdebatte, nein, so etwas würde es hier niemals geben.
Immer wieder fällt mir auf, wie unaufgeregt über Themen geredet wird, die bei uns mittlerweile die Menschen entzweien. Wie würde man hierzulande reagieren, wenn ein Minister, der Sikh ist, seinen Turban tragen würde oder eine Abgeordnete Kopftuch. Mich überrascht eine Kirche unweit des Parlaments in Ottawa. Deutlich sichtbar ist ein grüner Halbmond, unübersehbar der Zusatzvermerk „Solidarity.“ Ein paar Wochen zuvor hatte es einen Anschlag auf eine Moschee gegeben. Ja, Kanada ist anders. Als Europäer reibt man sich die Augen. Können wir aus den Erfahrungen lernen? Sollten wir? Aber geht das überhaupt? Sicherlich haben uns die Kanadier eines voraus: Sie wissen, worüber sie reden, wenn es um Diversität geht. Unterschiede werden zelebriert und hochgehalten. Einig ist man sich freilich, wenn es um die kanadischen Werte geht. Die werden von niemandem in Zweifel gestellt. Kanada ist eine durch und durch westliche Gesellschaft, sehr europäisch. Vielleicht sogar das bessere Europa.

Noch sind die Rechtspopulisten sehr ruhig. Das liegt daran, dass die Vorzüge der Zuwanderung klar ersichtlich sind. Postfaktische Hetze oder opportunistische Symbolpolitik greifen nicht wie hierzulande. Noch ist die Politik nicht vom mitteleuropäischen Stumpfsinn erfasst. Das hängt auch damit zusammen, dass Probleme nicht unter den Tisch gekehrt werden. Probleme wären da, um gelöst zu werden. Das hören wir oft. Ganz anders als bei uns in Mitteleuropa, wo Probleme dazu dienen, Ängste zu schüren. Nicht Ideologie, sondern Pragmatismus bestimmt die Migrationspolitik. Immer wieder ist von „managed migration“ die Rede. Die Menschen haben das Gefühl, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Kontrollängste gibt es nicht. Alles ist nachvollziehbar. Die Zahlen aus dem Vorjahr sind beeindruckend: Etwa 160.000 Menschen wandern jährlich „regulär“ nach Kanada ein, indem sie sich bewerben und akzeptiert werden, weil sie bestimmten Kriterien entsprechen. 11.000 weil sie als Asylwerber persönlichen Schutz suchen, 25.000 als Kontingentflüchtlinge, weil der kanadische Staat bereit ist, seine Verpflichtungen als Mitglied der internationalen Gemeinschaft wahrzunehmen. 85.000 kommen im Rahmen der Familienzusammenführung. Das erschreckt niemanden, weil die Menschen wissen, wie wichtig es ist, seine Lieben um sich zu haben. Die Erinnerung daran, selbst eingewandert zu sein ist allgegenwärtig. Wir treffen Vertreter einer Organisation, deren Gründer italienische Einwanderer waren und die sich momentan um syrische Kontingentflüchtlinge kümmern. Diese wurden im Rahmen des Resettlement-Programms aufgenommen. Menschen, deren Auswahlkriterium es war, zur Gruppe der „most vulnerable“ zu gehören. Aufnahmekriterium war nicht die beste Integrationsmöglichkeit, sondern die besondere Hilfsbedürftigkeit. Wie jetzt bei der Aufnahme von beinahe 2000 jesidischen Binnenflüchtlingen aus dem Nordirak.
Initiative für Flüchtlings-Patenschaften
Wenn NGOs oder Privatbeteiligte Patenschaften eingehen, sind auch persönliche Präferenzen möglich. Dieses Partnerschaftsprogramm ist einzigartig, weil sich Menschen einfach zu Gruppen zusammenschließen können, um Verantwortung für eine oder mehrere Personen zu übernehmen: finanziell, als Mentor und Begleitperson. Nach unserer Rückkehr haben wir Anträge im Rahmen der Reform des europäischen Asylwesens eingebracht, derartiges auch in Europa zu ermöglichen. Es sieht gut aus.
Ja, es ist notwendig, von anderen Kulturen zu lernen. Was Migration und Flucht anbelangt auf jeden Fall von Kanada. Am Rückflug über den Atlantik ist sie wieder präsent, die Fracture Zone. Der Flug ist unruhig, ich träume vor mich hin und wache immer wieder auf. Nein, ich werde aufgeweckt, von Gespenstern, die Donald Trump und Steve Bannon ähnlich sehen. Ich habe das Gefühl, als würde unter mir alles ins Wanken geraten, Amerika und Europa sich rasant voneinander entfernen. Ich höre Nummer 45 sagen, dass nach der Mauer zu Mexiko auch eine solche zu Kanada notwendig wäre. Das, was mir seit meiner Kindheit vertraut war, die westliche Wertegemeinschaft, scheint sich gerade aufzulösen. Der Atlantik verbindet nicht mehr. Die Bruchzone ist allgegenwärtig. Alles vorbei? Mitnichten. Die Krise ist Europas Chance und Verpflichtung zugleich.
Page 3 of 14
Selten war ich so erleichtert. Nicht nur ich. Noch nie wurde ich auf den Gängen des Europäischen Parlaments in Brüssel von so vielen Menschen aus ganz Europa umarmt und geküsst. Erleichterung, Dankbarkeit und Freude. Vielleicht war 2016 doch nicht das annus horribilis. Alle hatten wir uns schon damit abgefunden. Und nun das. Freude, edler Götterfunken. Erstmals wurde etwas aufgehalten, was den Kontinent wie eine Lawine zu überrollen drohte. Aufgehalten heißt freilich nicht gestoppt. Wie war ich doch nervös gewesen. Vielleicht habe ich zu viel in Geschichtsbüchern gelesen. Aber ich habe dem 4. Dezember 2016 entgegen gezittert, weil es um eine Weichenstellung ging und dieser Tag einer hätte sein können, an dem sich Geschichte ereignet. Unwiederkehrbar. Ein Hofer Sieg hätte eine Weichenstellung Richtung autoritärer Staat, Richtung Ostblock und Richtung Vergangenheit bedeutet. Das ist vorerst abgewendet. Ich freue mich für Van der Bellen und sein Wahlkampfteam. Wir haben ein würdiges Staatsoberhaupt. Es war eine große Leistung in diesem Jahr der permanenten Bundespräsidentenwahl, den Überblick zu behalten und die Kräfte effektiv zu bündeln. Well done!
Es war eine Entscheidung gegen…
Aber es war nicht nur ein Sieg Van der Bellens. Es war eine Mehrheitsentscheidung des österreichischen Volkes gegen etwas, das man als nicht beherrschbar, als bedrohlich empfand: eine wahrscheinliche Machtübernahme durch die Rechtsdemagogen. Eines der Hauptmotive war Angst. Angst vor jenen, die systematisch Angst schüren. Eine bunte Koalition, wie es sie in Österreich bisher noch nie gegeben hat. Quer durch politische Milieus, soziale Zugehörigkeiten und regionale Herkunft, getrieben vom spontanen Engagement von Menschen, deren Handeln parteipolitisch nicht gesteuert war. Die für Österreich so bestimmenden Lagergrenzen existierten nicht mehr. Es war eine mächtige Koalition von prekär Beschäftigten und Großindustriellen, von Studierenden und Lehrenden, von Laizisten und religiös Überzeugten. Die Klammer war der Vorsatz, keine ideologisch motivierten Veränderungen zu akzeptieren, gemeinsame Werte wie Freiheit und Toleranz zu garantieren und sich nicht in nationalistische Verstrickungen einzulassen. Das Bekenntnis zur europäischen Integration, die Ablehnung von Grenzzäunen und Akzeptanz von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten standen im Zentrum. Diese Koalition umfasste die ganze Bandbreite des „Gutmenschentums“. Es ist fraglich, ob sich so etwas wiederholen lässt. Mit Recht kann man fragen, ob es sich um ein letztes (allerletztes) Aufgebot handelte oder gar um den Beginn von etwas Neuem. Die Antwort wird sich in den nächsten Monaten weisen. Noch ist es dafür zu früh.
In der Falle der Rechtsdemagogen
Eines steht fest. Das Land ist in Geiselhaft der Rechtsdemagogen. Das hat sich schleichend vollzogen und eigentlich schon mit dem Aufstieg Jörg Haiders vor 30 Jahren begonnen. Die etablierte Politik hat nie eine Antwort darauf gefunden. Wir haben uns daran gewöhnt, Äußerlichkeiten für das Wichtigste zu halten, auf Provokationen hereinzufallen und statt zu wählen, Denkzettel zu verteilen. Vor allem die Fakten wurden notorisch ignoriert. In diesen 30 Jahren hat sich Österreich in erstaunlicher Weise weiterentwickelt. Wir gehören zu den ökonomisch erfolgreichsten, sozial stabilsten und sichersten Mitgliedsstaaten der EU. Töricht setzt man sich darüber hinweg und macht das Land herunter. Wie abgehoben ist das. Der politische Betrieb hat sich von den Bedürfnissen und Sorgen der Menschen abgekoppelt und ist zu einer gespenstischen Parallelwelt geworden. Wo es um Hahnenkämpfe, Inszenierungen und Symbolik geht: So tun, als ob und verhindern, dass andere Erfolg haben. Und die Wahrheit steht nicht unbedingt im Mittelpunkt. In diesem Polit-Biotop spielt die FPÖ den Hecht im Karpfenteich. Die Medien interessieren sich natürlich nicht für die trägen Karpfen, sondern für den aggressiven Hecht. Damit fördern sie ein Zerrbild der politischen Realität. Wie der politische Betrieb organisiert ist, das ist das große Problem Österreichs. Und die Medien sind Teil dieses Problems. Manche wirken wie Echokammern der Rechtsdemagogen. Verstärkt werden sie durch einen verantwortungslosen Gebrauch der sozialen Medien. Kommunizierende Gefäße.
Angst essen Seele auf
Diese auf einfache Botschaften und Schuldzuschreibungen reduzierte Realitätsverzerrung trifft auf eine verängstigte Bevölkerung. Wie in allen westlichen Industriestaaten grassieren Abstiegsängste. Die Angst ist zu einem gesellschaftlichen Phänomen geworden: Angst, den Job zu verlieren, Angst, aus dem sozialen Netz zu fallen, Angst um die Ersparnisse… Die Menschen sind verunsichert. Sie haben das Gefühl auf schwankendem Boden zu stehen und sie sind empfänglich für den Negativismus der Rechtsdemagogen. Deren vorwiegend negative Grundbotschaft wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Allzu leicht mutiert sie zu Hass. In einer solchen Stimmung werden Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt. Der Raum für differenzierte Argumente und sachlich begründete Lösungen schwindet. Wenn es am Realitätsbezug mangelt, dann werden politische Auseinandersetzungen zu Glaubenskriegen. Österreich ist mitten drinnen. Das Land ist tief gespalten. Das hat der Bundespräsidentenwahlkampf deutlich gemacht. Die Hetzer wurden zwar in die Schranken gewiesen, aber das Klima ist vergiftet. Nachhaltig. In einer derartigen Situation sind keine Triumphgefühle über die Besiegten angebracht. Abrüstung ist angesagt. Das funktioniert nur, wenn man versucht, das Gespräch mit der anderen Seite zu suchen. Mit den Rechten reden, verhindert, dass sie sich in ihrer paranoiden Parallelwelt einrichten. Mit den Rechten reden, heißt nicht wie die Rechten reden. Mit den Rechten reden bedeutet, sie mit Fragen zu konfrontieren. Freilich muss man dann auch bereit sein, ihre Antworten zu hören. Und man wird auch Unerwartetes und Unerfreuliches hören. Vor allem sollten wir uns im Klaren sein, dass nicht alle, die rechts gewählt haben auch Rechte sind. Nicht nur Modernisierungsverlierer sind darunter. Viele wurden enttäuscht, fühlen sich abgehängt und nicht respektiert. Immer wieder schlägt einem entgegen: Ihr hört uns doch gar nicht zu und ihr schert euch keinen Deut um uns.
Die Menschen wollen für etwas sein
Die Menschen wollen Aufmerksamkeit, Respekt und Gerechtigkeit. Sich auf Diskussionen, auch auf kontroverse einzulassen, ist ein Zeichen von Stärke. Wie oft rümpfen auch jene, die sich für fortschrittlich halten, die Nase, wenn jemand Unangenehmes sagt. Wie schnell sind wir mit dem Satz: „Dazu gibt es keine Alternative“, zur Stelle. Es ist nicht angebracht unsichere Menschen besserwisserisch abzukanzeln. Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit sind leider weit verbreitet. Obendrein töricht, weil dadurch die anderen bloß in ihrer Abwehrhaltung bestärkt werden. Wir sollten uns endlich abgewöhnen, die Rechtschreib- und Grammatikfehler der Rechten wichtiger zu nehmen als die dahinterstehenden Inhalte. Politische Auseinandersetzungen müssen inhaltlich geführt werden. Und es müssen die Alternativen sichtbar gemacht werden. Politische Bewegungen sind erfolgreich, wenn sie einzelne Maßnahmen in eine Erzählung, in einen Erklärungszusammenhang verweben können. Christian Kerns „New Deal“ ist ein erfolgsversprechender Versuch. Er wird dann funktionieren, wenn wieder sichtbar wird, was die einzelnen Parteien voneinander unterscheidet und wenn die Politik ihr Allmachtsversprechen, alles lösen zu können aufgibt. Es wird Zeit für eine Repolitisierung. Und wir sollten uns nicht davor fürchten, wenn die Dinge beim Namen genannt werden. Vor allem die Sozialdemokratie darf nicht herumdrücken, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht. 85 % FP-Wähleranteil bei den Arbeitern das muss die Alarmglocken schrillen lassen. Die Arbeiterschaft lässt sich nur dann zurückgewinnen, wenn die österreichische Politik wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehrt. Wenn sie sich aus dem Reich der Fantasien und Hirngespinste zurückzieht und vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Solange mit Recht verunsicherte Menschen den postfaktischen (eigentlich kontrafaktischen) Echokammern des Boulevards und der Rechtsdemagogen verfangen bleiben, wird sich wenig ändern.
Viele wollen sich einmischen
Die Bundespräsidentenwahl hat gezeigt, dass sich viele g e g e n etwas mobilisieren ließen. Wahrscheinlich, weil es auch darum ging, etwas zu verteidigen: Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, Europa, die EU. Hatte es nicht immer geheißen, Europa könne man nicht lieben. Und plötzlich engagierten sich tausende Menschen, die es bislang vorgezogen hatten, sich nicht zu engagieren. Sie hatten ein privates Leben dem öffentlichen Engagement vorzogen oder waren vom politischen Betrieb angewidert. Ich kenne viele, sehr viele solcher Menschen. Deren unerwartetes und vor allem freiwilliges Engagement ist das wichtigste Resultat dieser Wahlauseinandersetzung. Ja, ohne die Zivilgesellschaft wäre ein anderer Bundespräsident geworden. Unter den VdB-Supportern waren viele, denen man Blauäugigkeit vorwarf, weil sie im Sommer 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise wussten, was zu tun war. Im Gegensatz zur Staatsspitze, die es damals vorzog wochenlang zu schweigen, die Bevölkerung in ihrer Unsicherheit alleine ließ und erst handelte, als es zu spät war. Ich habe damals geschrieben: „Gerade jetzt wäre es für die staatstragenden Parteien wichtig, auf diese Menschen zuzugehen. Weitaus wichtiger als das Schielen auf verantwortungslose Hetzer und Demagogen. Also auf die Rücksichtsvollen Rücksicht nehmen und nicht auf die Rücksichtslosen.“ Es war in den Wind geschrieben. Niemand hatte ein Interesse an grundlegenden Veränderungen. Und die Fortsetzung des „business as usual“ war Wasser auf die Mühlen der Rechtsdemagogen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Politikbetrieb, kapiert doch endlich, die Menschen sind nicht politikmüde, sie wollen mitmachen und sich einbringen. Sie sind lediglich unzufrieden mit uns und mit der Art und Weise, wie wir die Politik organisieren. Lasst uns doch die Lehren daraus ziehen.
Politik kann man auch anders gestalten
Wann, wenn nicht jetzt sollten wir uns fragen, warum alles so schief gelaufen ist. Warum nicht mehr viel gefehlt hat und wir ins Unberechenbare gekippt wären. Selbstkritik ist angesagt. Und Mut. Deshalb müssen wir auch hinterfragen, ob die Geschäftsgrundlage des österreichischen Politikbetriebs, die Bundesverfassung noch tauglich ist. Sie ist innerlich und äußerlich eine Ruine, wie das der Verfassungsrechtler Theo Öhlinger im Zusammenhang mit dem Österreichkonvent formulierte. Schon einmal hatte man ähnliches versucht, sogar beachtenswerte Übereinstimmung erzielt, aber dann ging man zur Tagesordnung über. Mehr als zehn Jahre sind seitdem vergangen. Nicht immer stimmt das österreichische Mantra: Glücklich ist, wer vergisst.
Die Baustellen sind die gleichen geblieben, nur größer. Noch immer hemmt der ausufernde Föderalismus die Gestaltungsmöglichkeiten und erlaubt egomanen Landesfürsten die gesamte Republik in Geiselhaft zu nehmen. Die Parlamente sind häufig nicht viel mehr als Absegnungsmaschinen für die Regierungspolitik und ein freies Mandat der Abgeordneten bleibt Wunschtraum. Auch die Unabhängigkeit der Justiz ist eine immerwährende Aufgabe und das Vertrauen in die Exekutive könnte besser sein. Ja, und in der EU ist Österreich auch 20 Jahre nach dem Beitritt immer noch nicht angekommen. Und es darf auch erlaubt sein, zu fragen, ob wir das Amt des Bundespräsidenten in dieser Form noch brauchen. Ein Jahr lang sind wir auch ohne ganz gut ausgekommen. Viele offene Fragen. Die Antworten können wir nicht vor uns herschieben. Wir brauchen einen neuen Rahmen für politische Teilhabe in diesem Land. Einen Rahmen, der es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich einzubringen. Faktenorientiert und auch kontrovers. Vom Unterschied lebt die Demokratie. Eine funktionierende Demokratie ist die beste Absicherung gegen zerstörerische Demagogie. Jetzt wäre die Stunde da, eine breit angelegte Diskussion über die Zukunft unserer Demokratie zu starten. Eine solche zukunftsorientierte Debatte, die in einem neuen Österreichkonvent münden müsste, würde wahrscheinlich dazu beitragen, die Gräben zu überwinden, die uns gegenwärtig trennen und die Entwicklung lähmen.
Große Veränderungen kommen auf leisen Sohlen. Wenn man sich bei Menschen umhört, die mit Politik wenig am Hut haben, dann begegnet einem eine eigenartige Ignoranz, sobald die Rede auf den 4. Dezember kommt. Was soll da schon passieren? Ein ganz unwichtiges Amt hört man allerorten. Schließlich seien wir jetzt auch ein halbes Jahr ohne einen Bundespräsidenten ausgekommen. Und was kann er schon bewirken? Reden halten, unterschreiben, hin und wieder ein bisschen mahnen. So war es die letzten 70 Jahre. So wird es aber künftig nicht mehr sein. Der Grundkonsens der Zweiten Republik ist zerbrochen. Das Land ist gespalten und ein diffuser Wunsch nach Veränderung liegt in der Luft. In einer derartigen Konstellation könnte ein Bundespräsident zum Angelpunkt des Umbruchs werden. Das hängt damit zusammen, dass das Amt des österreichischen Bundespräsidenten 1929 – zu einem Zeitpunkt wo ganz Europa in Richtung Führerstaat abdriftete – neu konzipiert worden war. Die Weimarer Reichsverfassung diente als Vorbild. Nach 1945 gab es glücklicherweise ein anderes Amtsverständnis: Kein Führer-Präsident sondern ein gutmütiger Ersatzmonarch, der hin und wieder grantig seine durfte. Die ihm zustehenden Befugnisse hätten mehr erlaubt, allerdings erstickten alle dahin gehenden Versuche an einer, demokratischen Erneuerung, erdrückenden Harmoniesucht.
Die Zeiten haben sich freilich geändert. Konfrontation ist plötzlich chic. Die allgegenwärtige Angst verwandelt sich in Hass. Was lange lähmte, treibt nun an. Die neuen Helden sind die Vereinfacher. Es genügt, wenn sie lautstark vorgeben Lösungen zu kennen. Kompromiss, Differenziertheit und Lösungskompetenz werden als Schwäche ausgelegt. Wieso sollte ein künftiger Bundespräsident nicht versuchen, das Amt im Sinn einer autoritären Reduktion der komplexen, für große Teile der Bevölkerung schwer ertragbaren Realität anzulegen. Kraft seiner Befugnisse könnte er zu einer Art Super-Schiedsrichter werden, der über den Parteien stehend, diese vor sich hertreibt und der Politik seine Agenda vorgibt. Von Van der Bellen ist zu erwarten, dass er dem bisherigen Rollenverständnis eines Bundespräsidenten entspricht. Er ist sich der Notwendigkeit einer Erneuerung bewusst, aber er weiß auch um seine Befugnisse. Der Bundespräsident hat vor allem eine begleitende Rolle: anregend, wenn nötig einmahnend, immer vermittelnd. Und er muss die Koordinaten Österreichs kennen: Westorientierung und Verankerung in der europäischen Wertegemeinschaft, Achtung der Menschenrechte und Bewahrung der Rechtsstaatlichkeit. Diese Fixpunkte zu ändern ist dem vom Volk gewählten Parlament vorbehalten. In besonderen Fällen, wie zuletzt beim Beitritt zur EU auch einer plebiszitären Entscheidung.
Die Quadratur der Prinzipienlosigkeit
Hofer verspricht einen radikalen Wechsel. Geschickt spricht er die Angst-und Ohnmachtsgefühle der Menschen an. „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist.“ ist der wohl meist zitierte Sager in diesem nicht enden wollenden Wahlkampf. Er klingt wie ein Menetekel und er erlaubt breiten Raum für Interpretation. Wie so vieles an diesem Kandidaten. Einmal so, dann wieder anders, schließlich doch nicht so. Irgendwie alles in der Schwebe und wieder doch nicht. Mitunter hat man den Eindruck, als ginge es darum permanent abzutesten, was möglich ist. Alleiniges Ziel ist die Optimierung von Wählerstimmen. Um jeden Preis. Deshalb greift die holzschnittartige Rhetorik so mancher zu recht besorgter Antifaschisten nicht weit genug. Hofer & Co. geht es nicht einfach darum, das Rad der Geschichte auf die Zeit vor 1945 zurückzudrehen. So sehr das vielleicht viele seiner Fans möchten. Das Bekenntnis zur deutschen Kulturnation ist ja fixer Bestandteil der burschenschaftlichen Milieus. Dazu zählt auch die Ablehnung einer österreichischen Nation oder der habsburgischen, multinationalen Vergangenheit.
Bemerkenswert ist, wie bereitwillig die Rechtsdemagogen nachhaltig gepflegte Feindbilder und Prinzipien über Bord werfen. Willfährig lässt man sich als Erfüllungsgehilfe geopolitischer Interessen instrumentalisieren. Die Schwächung der EU mag im Interesse des Kremls sein, den kleinen Leuten in Österreich, denen man permanent nach dem Mund redet, hilft das freilich nicht. Der kleine Mann dient der Stimmenmaximierung. Viel lieber lässt sich man sich in diversen Propagandamedien wie Sputnik-News abfeiern. Nachdem ein großer Teil der österreichischen Bevölkerung einen Öxit ablehnt, probiert man es jetzt durch die Hintertüre. Das Projekt einer Allianz mit den Visegrád-Staaten, von den russischen Freunden auch Ost-Benelux genannt, dient in erster Linie der Desintegration Europas. Stärkung der Zentrifugalkräfte, darum geht es. Dafür ist man gerne bereit beim Gespräch mit Miloš Zeman, das Thema Temelín nicht anzuschneiden. Oder Václav Klaus nicht mit den Benesch Dekreten zu behelligen. Jahrzehntelang hatte man sich einer Annäherung an den tschechischen Nachbarn mit dem Hinweis entzogen, dass diese Frage nach wie vor offen sei. Und die Osterweiterung hatte man sowieso massiv bekämpft. Solange zumindest, bis klar wurde, dass sie nicht automatisch in einer Stärkung der EU münden müsse. Orbán wurde erst dann zum Freund, als er begann sich von Brüssel abzusetzen, um schließlich in der Flüchtlingsfrage gänzlich aus der europäischen Solidarität auszuscheren.
Wenn man Europa zerstören will, muss man die EU kaputt machen
Solche Töne, noch dazu aus der unmittelbaren geographischen Nachbarschaft, sind Musik für die Ohren der Rechtsdemagogen auf europäischer Ebene, wo die FPÖ eine wichtige Rolle spielt. Gegenwärtig sind sie auch nicht prinzipiell gegen Europa unterwegs. Die Beschwichtigungsformel „Europa der Vaterländer“ geht ihnen leicht von den Lippen. Sie bekämpfen die Idee einer Europäischen Union, eines supranationalen Souveräns. Nie konnten sie sich mit dem Faktum eines durch Einsicht und Vernunft begründeten europäischen Einigungswerks, das auf den Fundamenten von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten beruht, abfinden. Verständlich, ist das europäische Einigungswerk doch die Antithese zum nationalistischen Zerstörungswahn, der Europa bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts permanent heimgesucht hatte. Geschickt nutzten die Rechtsdemagogen die reichlich vorhandenen Probleme auf europäischer Ebene, um sie in ihren nationalistischen Erklärungszusammenhang zu verweben. Sie nahmen zwar Positionen in den europäischen Gremien ein, ließen sich dafür bezahlen, lehnten aber alles ab, was Europa besser und effektiver gemacht hätte: Nein zu einem gemeinsamen Sitz des Parlaments, um dann die Verschwendung von Mitteln anzuprangern. Immer wieder nein zu einer gemeinsamen europäischen Einwanderungs- und Asylpolitik, um dann zu beklagen, dass die EU nichts zustande bringt. Sie hassen diese EU. Immer und überall. Wenn die europäische Hymne im Parlament intoniert wird, dann bleiben sie ostentativ sitzen. Auf ihren Sitzen im Europaparlament pflanzen sie die Flaggen ihrer Nationalstaaten auf, so als ob sie Feindesland erobert hätten. Die Liste lässt sich fortsetzen. Das Credo ist immer das gleiche: Die EU darf nicht funktionieren. Jahrelang ist man auf dieser Welle der Ablehnung und Übertreibung gesurft. Mit Erfolg.
Alle, denen Europa ein Dorn im Auge ist, haben sich miteinander verbündetet. Ihre Gemeinsamkeit ist die Aversion. Sonst nichts. Keine Substanz. Ihre Freunde außerhalb Europas könnten gar nicht unterschiedlicher sein: Putin und Trump trennen trotz aller Gemeinsamkeit Welten. Dieses Bündnis wird so lange halten, bis die EU zerstört ist. Dann werden sie übereinander herfallen. Wie so oft in der Geschichte. Gerade in Österreich sollten wir wissen, dass wir als kleines Land nur dann überleben können, wenn wir unsere Souveränität im Einklang mit anderen Staaten gestalten. Die Erste Republik ist mahnendes Beispiel dafür, wohin Bündnislosigkeit führen kann. Österreich konnte nur deswegen zu seiner heutigen Bedeutung finden, weil es sich nach 1945 dem Westen verpflichtet fühlte. In seiner Außenpolitik zwar strikt neutral wurde es zum integralen Bestandteil eines auf Werten und Prinzipien beruhenden Bündnisses. Unser Erfolg resultierte daraus, dass wir es vermochten, uns als Schaufenster des Westens zu dekorieren.
Mit dem Beitritt der östlichen Nachbarn wurden wir in die Mitte des Kontinents katapultiert. Und wir konnten eine gewaltige Dividende kassieren. Freilich waren wir nicht bereit und nicht in der Lage, die Chancen dieser historischen Konstellation zu nutzen. Es waren vor allem die Rechtsdemagogen, die dagegen mobilmachten. Eine Zusammenarbeit hätte ja den Integrationsprozess stärken können. Sie wurden nicht müde gegen die Osterweiterung zu wettern. Jetzt aber, wo im Osten der Wind der illiberalen Demokratie bläst, Orbán und Co. – unter dem Beifall von Putins Russland – sich immer unverfrorener über die Kopenhagen-Kriterien, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft hinwegsetzen, beginnen die Rechtsdemagogen sehnsüchtig nach Osten zu blicken. Sie beschwören eine gemeinsame Geschichte, die sie immer abgelehnt haben, und negieren unterschiedliche ökonomische und rechtsstaatliche Standards, auf die sie immer aufmerksam gemacht haben. Hofer hat in der zweiten Runde der Wahlauseinandersetzung immer wieder betont, wie wichtig ihm eine Öffnung nach Osten und ein Beitritt zur Visegrád-Gruppe sind. Er spielt mit dem Feuer und nimmt eine Schwächung der für Österreich so wichtigen europäischen Integration in Kauf. Dieser Flirt mit dem Osten macht ihn zum Spielball geopolitischer Interessen und treibt ihn in die Arme von immer wichtiger werdenden Akteuren, wie Alexander Dugin, dem es um eine von Moskau angeführte „Eurasische Union“ als Gegenmodell zum „westlichen Nihilismus“ der globalisierten Eliten geht.
Die Wahl des österreichischen Bundespräsidenten ist eine Richtungsentscheidung. Es geht um die Frage, ob wir uns auf ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang einlassen wollen. Das Amt des österreichischen Bundespräsidenten könnte wie ein Brandbeschleuniger wirken.
Es ist eine der schönsten Gegenden auf diesem Globus. Atemberaubend der Blick hinunter aufs Meer, im Hintergrund die schneebedeckten Gipfel des Olymp. Die alten Griechen hatten hier ihre Götter verortet. Wo sonst. Am Sonntag war ich mit meiner Kollegin Ana Gomes (S&D-Portugal) im idyllischen Petra. Es war viel mehr als eine „Fact-Finding Mission“. Wir wollten ein Zeichen der Verbundenheit mit den Jesiden setzen. Die meisten von ihnen sind seit August 2014 auf der Flucht. Damals hatten die IS/Daesh-Terroristen mit dem Genozid an dieser religiösen Gruppe, deren Geschichte viel älter ist, als die der Muslime oder Christen begonnen. Furchtbares haben sie mitgemacht, ihre Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, Männer und alte Frauen wurden erschossen, geköpft und in Massengräbern verscharrt. Junge Frauen und Mädchen wurden gefangen genommen, versklavt und auf das Übelste missbraucht. So etwas lastet auf den Menschen. Wann immer man mit Jesiden zusammen ist, landet das Gespräch bei diesen traumatischen Erfahrungen. Viele wollen bloß, dass man ihnen zuhört.
Zu den historischen Erfahrungen der Jesiden gehört es, dass ihnen wenige zuhören. Ihre Urangst ist es, vergessen zu werden. 74-mal in ihrer Geschichte waren sie von einem Genozid betroffen. Unrecht und Verfolgung waren alltägliche Erfahrungen. Sogar nach geglückter Flucht. Ich habe in den letzten beiden Jahren immer wieder Kontakt zu geflüchteten Jesiden gesucht. Ich habe es im Jänner 2015 dem Baba Sheikh versprochen.
Egal, ob im türkischen Diyarbakir oder im griechischen Idomeni und den daraus hervorgegangen Auffanglagern, Verfolgung und Diskriminierung sind allgegenwärtig. Immer wieder wurden Jesiden tätlich angegriffen. Im August haben die griechischen Behörden endlich darauf reagiert und eigene Lager eingerichtet. Der Großteil der Jesiden befindet sich gegenwärtig in Serres und in Petra. Die Zustände sind katastrophal und entsprechen bei Weitem nicht den ohnehin sehr niedrigen Standards griechischer Flüchtlingslager. Zelte, kaum Toiletten und Duschen, keine funktionierende Elektrizitätsversorgung und nicht genießbare Verpflegung. Viele Menschen sind krank, husten. In Serres zeigt mir ein Mann ganz stolz Boxen, mit Hasenställen vergleichbar und meint, dass es den Kindern jetzt besser ginge, weil sie nicht mehr im kalten Zelt schlafen müssten.
Die Kälte und vor allem die Angst vor dem nahenden Schnee beunruhigen die Menschen. Vorsorglich haben sie Holz gesammelt, mit dem sie ihre aus Blechkanistern gefertigten Öfen beheizen. Es ist unmenschlich, die Flüchtlinge auf solche Weise der Witterung auszusetzen. Bei unserem Besuch erzählen sie, noch immer ganz verstört, dass in der Nacht ein Wolkenbruch niedergegangen wäre und viele Kinder voll Angst geweint hätten.
Noch immer kommen mir diese Bilder unter. Nein, und nochmals nein: So etwas darf es in Europa nicht geben. Unseren griechischen Gesprächspartner blieb unsere Betroffenheit nicht verborgen. Sie versprachen innerhalb von 10 Tagen die Menschen in geeigneten Quartieren unterzubringen. Nichts würde ich mir mehr wünschen. Ich hoffe, dass sie dieses Versprechen einhalten. Wenn nicht, dann soll das geschehen, was die alten Griechen an diesem magischen Gipfel des Olymp verorteten: Dann soll sie der Zorn des Göttervater Zeus treffen, der mit Blitz und Donner Frevler und Untreue bestrafte.
Diesen Freitag ist für mich eine Ära zu Ende gegangen. Ich habe meine Tätigkeit als Funktionär der Volkshilfe beendet. Es ist das offizielle Ende. Faktisch habe ich mich schon länger zurückgezogen. Sukzessive seit Oktober 2014, als ich meinen Rückzug aus allen Funktionen angekündigt habe. Wir sind damals übereingekommen, diesen Wechsel in der Führung für eine organisatorische und personelle Erneuerung zu nutzen. Ich bin sehr froh, dass mit Michael Schodermayr ein Nachfolger bereitsteht, der der oberösterreichischen Volkshilfe in den schwierigen Zeiten – die auf uns alle zukommen werden – voran stehen wird. Er ist ein uneitler Mensch, einer mit Ausstrahlung und Gemeinsinn. Er kann andere begeistern. In den letzten Monaten hat er bewiesen, dass er in der Lage ist, mit Schwierigkeiten geduldig und zielstrebig umzugehen. Ihm ist gelungen, woran ich notorisch gescheitert bin, die dringend erforderliche Organisationsreform der Oberösterreichischen Volkshilfe umzusetzen. Dafür möchte ich ihm danken.
Einmal Volkshilfe- immer Volkshilfe
Ich werde in Zukunft zwar weiterhin mit jeder Faser hinter der Volkshilfe Oberösterreich stehen, mich künftig aber darauf beschränken, nur über Vergangenes zu reden. Vergangenheit steht ja genug zur Verfügung. 31 Jahre, fast die Hälfte meines Lebens habe ich auf unterschiedlichen Ebenen in der Volkshilfe vorne mitgemischt. Von 1985 bis 1991 als Linzer Vorsitzender, seit 1987 als Vorsitzender in Oberösterreich, von 1991 bis 2015 als Präsident der Österreichischen Volkshilfe und von 2007 bis 2014 als Präsident des europäischen Dachverbandes solidar. Das reicht – zumindest meine Frau Inge wird sich das oft gedacht haben. Und sie hat recht. Ich bin ihr und unserer Familie zu Dank verpflichtet, dass sie meine häufige Abwesenheit akzeptiert haben. Es müssen viele Abende gewesen sein. Als Mathematikerin weiß meine Frau: 31 mal 52 mal x. Da ist man schnell im vierstelligen Bereich. Auf jeden Fall waren es viele, viele Abende. Vielleicht zu viele, im Nachhinein betrachtet. Die Gutmütigkeit und Toleranz meiner Familie habe ich oft überstrapaziert. Aber es ging ja auch um etwas sehr Wichtiges, das noch dazu von Jahr zu Jahr wichtiger zu werden schien. Es sollte nicht nur uns gut gehen, sondern auch den anderen, allen anderen… der Menschheit. 1968 hatte seine Spuren hinterlassen. Das kann mitunter anstrengend sein. Für alle Beteiligten.
Eigentlich war es nicht selbstverständlich, dass ich bei der Volkshilfe landete. Meine Welt war der Hörsaal, das Seminar, die Bibliothek. Ich war sehr jung, als ich Universitätsprofessor wurde und damit über alle Maßen privilegiert. Wer hat schon das Glück, dass die Republik einem als 33-Jährigen eine Lebensstellung garantiert? Damals nahm ich mir vor nicht abzuheben und der Gemeinschaft, die mir dieses Privileg verschaffte, dankbar zu sein. Ich wollte mich engagieren. Und ich wollte mich politisch engagieren. Natürlich war mein akademisches Umfeld politisch gewesen, aber es gehörte auch dazu, sich nicht von der Parteipolitik vereinnahmen zu lassen. Eine Gastprofessur in England ließ mich davon abrücken. Ich konnte persönlich erleben, welche verheerenden Folgen die neoliberale Politik von Margaret Thatcher in einer englischen Industrieregion wie den Midlands angerichtet hatte. Und ich wollte nicht, dass das auch bei uns passiert, und beschloss meine akademische Zurückhaltung aufzugeben. Für einen Professor lag es nahe sich in der Bildungsarbeit der SPÖ zu engagieren. Aber zu meinem Erstaunen wollte das von den Verantwortlichen niemand. Erst viel später erfuhr ich den Grund: Der Bezirksbildungsvorsitzende der SPÖ Linz gehörte dem Parteipräsidium an. In solchen Kategorien dachte ich damals nicht und ich kann es auch heute noch nicht.
Auf jeden Fall bin ich Josef Ackerl dankbar, dass er mir anbot den Vorsitz der Linzer Volkshilfe zu übernehmen, deren Tätigkeitsbereich damals noch überschaubar war. Und ich bin dem Schicksal unendlich dankbar für diesen glücklichen Zufall. In dieser Funktion konnte ich nicht nur anderen helfen. Vielmehr war es auch zu meinem eigenen Vorteil. Im Gegensatz zu vielen meiner Professorenkollegen hatte ich einen Bezug zur Realität. Ich wusste, wovon ich redete, weil ich konkrete Menschen vor Augen hatte. Theorie und Praxis zu verbinden, das war es ja, was wir 68er gefordert hatten. Die Welt zu verändern, ein bisschen zumindest, das war unser Antrieb. Und plötzlich war ich dort, wo ich immer sein wollte, bei Karl Marx und seiner 11. Feuerbachthese: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt aber darauf an, sie zu verändern!“ Und ich konnte wirklich einiges verändern. Ich habe meinen Beruf als akademischer Lehrer sehr geliebt und glaube, dass es mir auch gelungen ist, viele junge Menschen zu formen. Aber ohne diese Symbiose mit der Arbeit in der Volkshilfe wär so was nie möglich gewesen.
Vor ein paar Wochen bin ich per Zufall über einen Text von Bert Brecht gestolpert. Er lässt mich nicht mehr los, weil er präzise zusammenfasst, was mir bislang in meinem Leben widerfahren ist: „Stark ist, wer Glück hat. Ein guter Kämpfer und ein weiser Lehrer ist einer mit Glück. Glück ist Hilfe.“ Glück ist Hilfe. Hilfe ist Volkshilfe. Ja, es gab viele solcher Glücksmomente in den letzten 31 Jahren. Vor allem wenn unsere Hilfe unvermittelt und unerwartet geschah. Wie oft haben mir Menschen dafür gedankt, dass ihre Angehörigen in der vertrauten Umgebung alt werden konnten und nicht ins Heim mussten, dass sie wieder einen Job fanden und damit ihr Leben einen Sinn oder dass nach Krieg und Vertreibung Oberösterreich für sie zur neuen Heimat wurde.
Stark ist, wer hilft. Schwach ist, wer hetzt.
Ja, die Flüchtlinge, ein Thema, das mich die ganze Zeit begleitete. „Helft doch den unseren“, wie oft habe ich das gehört. Und wie oft musste ich sagen: Ja, das tun wir natürlich – und mit viel mehr Einsatz als ihr Meckerer – aber kapiert doch: Wir Menschen sind alle gleich. Daher muss man zu allen Menschen menschlich sein. Überall. Punkt. Und noch etwas: Helfen ist keine One-Man-Show und kein Selbstzweck. Helfen ist ein Gemeinschaftserlebnis, helfen begründet Gemeinschaft, Solidarität. Nach außen und nach innen. Mir war es immer wichtig, dass unsere Beschäftigten nicht für Gottes Lohn arbeiten sollten. Zu helfen ist nicht nur Berufung, das ist vor allem Beruf. Professionalität ist Ausdruck der Wertschätzung des anderen. Sie muss fair und gerecht entlohnt werden. Viel, sehr viel, manche meinten, zu viel Zeit habe ich als Vorsitzender der BAGS dafür aufgewendet, einen gesamtösterreichischen Kollektivvertrag für den Sozialbereich zustande zu bringen. Viele Konflikte, viel zerschlagenes Porzellan und kein Ruhm, aber die Gewissheit, dass wir die Grundlage für geregelte Arbeitsverhältnisse im Sozialbereich schaffen konnten. Natürlich lässt sich darüber streiten, ob es nicht mehr hätte sein können. Aber es galt einen Ausgleich zu finden zwischen legitimen Anliegen und dem Machbaren. Ein eigenartiges Gefühl war es schon gewesen, Vorsitzender eines Arbeitgeberverbandes zu sein. Ich habe es gerne gemacht. Im Bewusstsein, dass eine Organisation nur dann bestehen kann, wenn sie ihre Beschäftigten wertschätzt.
Natürlich gibt es auch vieles zu bedauern. Ich will Euch damit verschonen. Nur eines: Es tut mir leid, wenn ich jemanden enttäuscht habe. Jeder Mensch macht Fehler. Eine Entscheidung werde ich allerdings niemals bedauern. Dass ich eines Tages, Mitte der 80er Jahre einen meiner ehemaligen Studenten gefragt habe, ob er nicht mit mir die Volkshilfe entwickeln möchte. Alles, sagen wir fast alles, was in den letzten drei Jahrzehnten in der Volkshilfe Positives geschah, das ist sein Verdienst. Je länger wir miteinander zusammenarbeiteten, umso besser funktionierte es. Ich konnte ihm blind vertrauen: Karl Osterberger ist das Beste, was der Volkshilfe in Oberösterreich passieren konnte. Ich danke ihm für alles: für die Loyalität in kritischen Momenten, für seine Offenheit und Ehrlichkeit, für seine immerwährende Bereitschaft Ideen aufzugreifen und für seine Freundschaft. Zudem hat uns als leidenschaftliche und bekennende Innviertler auch der Genuss des einen oder anderen Biers verbunden. Vielleicht ist das jetzt manchem zu viel Innviertel, zu viel Oberösterreich und zu viel Heimat. Ich habe da ganz klare Prioritäten. Heimat lasse ich mir nicht nehmen schon gar nicht von jenen, die sich provokativ soziale Heimatpartei nennen. Und Oberösterreich ist meine Heimat. Heimat ist in erster Linie Vertrautheit. Niemand hat das Recht, daraus abzuleiten er wäre besser, als die anderen. Wer seine Heimat wirklich liebt, dem kann es nicht egal sein, wenn jemand anderer die Heimat verliert. Brechts Überlegungen weiterführend: Stark ist, wer hilft. Schwach ist, wer hetzt.
Die nächsten Jahre werden schwierig, sehr schwierig. Ein Sturm ist aufgezogen, er könnte Europa und alles, was uns lieb geworden ist durcheinanderwirbeln. Die Menschen spüren das. Angst hat sich breitgemacht und lässt viele wider jede Vernunft handeln. Wir stehen auf schwankendem Boden. Schwindlig könnte einem werden. Ohnmachtsgefühle machen sich breit. In dieses Vakuum stoßen die autoritären Verführer, sie haben nichts anderes als die eigene Macht im Kopf. Sie brauchen Unsicherheit und reden uns unentwegt ein, wir würden den Boden unter den Füßen verlieren. Gerade deshalb müssen wir jetzt alles tun, um unsere Fundamente zu sichern: Demokratie und Menschenrechte, den Sozialstaat, Offenheit und Toleranz. Ich hoffe darauf, nein ich bin mir sicher, die Oberösterreichische Volkshilfe wird dabei eine wichtige Rolle spielen.
Ein Jahr ist vergangen seit diesem denkwürdigen Sommer 2015. Ein Sommer, der uns noch lange beschäftigen wird und von dem es vielleicht einmal heißen wird, damals hätte der endgültige Niedergang Europas eingesetzt. Noch ist es nicht so weit. Aber es ist schon sehr weit: Brexit, Vizegrad, Orbán und Kaczynski, (vielleicht bald) Le Pen und Wilders.
Wenn der Blick aufs große Ganze fehlt
Vor allem der anschwellende Chor jener, die unentwegt lamentieren, Europa würde nicht funktionieren, aber gleichzeitig alles daran setzen, dass es nicht funktioniert. Weil sie sich immer selbst die Nächsten sind. Nicht erst seit vergangenem Sommer und nicht erst seit David Camerons innenpolitisch motiviertem Brexit-Referendum.
Auch Angela Merkel, die heute vergeblich europäische Solidarität einfordert, hat 2010 drei lange Monate zugewartet, bevor sie nach den Landtagswahlen in NRW bereit war, die notwendigen Hilfsmaßnahmen für Griechenland zu setzen. Oder Victor Orbán. Er befand sich im Frühsommer 2015 im freien Fall und setzte auf Fremdenfeindlichkeit. Die daraus resultierende, überhastete Errichtung eines Grenzwalls an der Grenze zu Serbien sollte die Flüchtlingswelle erst richtig in Gang setzen.
Ohne Merkels taktisches Zaudern damals wäre aus einer Finanzmarktkrise nicht die Eurokrise geworden und ohne Orbáns perfides Manöver wäre die Flüchtlingskrise nicht zur europäischen Existenzkrise geraten. Europas Problem ist die Kurzsichtigkeit seiner Politikerklasse. Europas Problem sind die langfristig zum Scheitern verurteilten Nationalstaaten. Die Globalisierung hat sie schwach gemacht.
Es ist schon richtig, was Karel Schwarzenberg mit Blick auf Österreich dieser Tage so treffend formulierte: „In starken Staaten bestimmt die Außenpolitik die Innenpolitik und in schwachen Staaten die Innenpolitik die Außenpolitik“.
„Wir schaffen es nicht!“
Schwäche hängt mit mangelndem Selbstvertrauen zusammen. „Wir schaffen das“ hat Vertrauen signalisiert, weil es ein Zeichen von Stärke war. Davon ist nicht mehr viel übrig geblieben. Mittlerweile sonnen sich die meisten Vertreter der politischen Klasse geradezu in dem Gefühl, es nicht zu schaffen. Es schaffen zu wollen, ist schon halber Landesverrat. Politische Lösungen werden erst gar nicht mehr versucht. Dafür gefällt man sich in kleinräumiger, symbolischer Politik: Obergrenzen, Zäune, militärische Präsenz im öffentlichen Raum, Burkaverbot etc. Jede Woche etwas Neues.
Die Problemlösungseffekte solchen Tuns sind bescheiden. Allerdings verstärken sie von Mal zu Mal das Gefühl, man würde in einem permanenten Klima des Ausnahmezustandes leben. Der Ausnahmezustand aber ist das Biotop in dem autoritäre Politiker gedeihen. Die Flucht aus der politischen Verantwortung, wie wir sie gegenwärtig in der Flüchtlingskrise erleben, schafft erst den Raum für verantwortungslose Demagogen.
Deshalb sollten wir Merkels Verhalten in jenen kritischen Septembertagen würdigen.
Ja, Merkel hat entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, damals nicht gezögert und in einem ungewohnten Anfall von Entscheidungsfreude, in Absprache mit Werner Faymann die Grenzen geöffnet. Natürlich war sie von den Ereignissen getrieben, aber sie hat Fakten gesetzt. Wäre sie am 4. September 2015, als Orbán die Situation verantwortungslos eskalieren ließ, dessen Beispiel gefolgt und hätte die deutschen Grenzen dicht gemacht, was wäre dann gewesen? Vor allem was wäre mit Österreich passiert? Es wäre der Big Bang gewesen. Gerade jene Kreise in der ÖVP, die an der Politik Merkels kein gutes Haar lassen, sollten darüber nachdenken.
Merkels Grenzöffnung war ebenso wie der Türkei-Deal im Februar ein Versuch, die Krise in einem europäischen Rahmen zu lösen. Solches hatten ihre Opponenten Seehofer, Orbán & Co nicht im Sinn. Das haben deren kurzsichtige, ausschließlich an der Optimierung des persönlichen Profils orientierten Adepten niemals begriffen.
Merkels europäische Lösung funktionierte aus verschiedenen Gründen nicht. Sie war ganz im Sinne ihrer Präferenz für intergouvernementale Europapolitik nicht mit dem gemeinschaftlichen Europa akkordiert, wurde daher von vielen als „moralisches Oktroy“ oder (in Erinnerung an die austeritätspolitischen Maßnahmen) als neuerliche Anmaßung Deutschlands empfunden und sie war sprunghaft und inkohärent. Zu guter Letzt verlor sie auch die politische Zustimmung, die ursprünglich im Übermaß vorhanden war. Vor allem aber scheiterte sie, weil nicht konsequent an die Integration hunderttausender Flüchtlinge herangegangen wurde. Nach wie vor leben Tausende in Notunterkünften und in vielen Fällen sind die Asylverfahren noch immer nicht eröffnet.
Eine neue Dolchstoßlegende
Dieses Versagen ist der Grund, warum sich in der Bevölkerung massive Ängste breit gemacht haben. Vorfälle in die Flüchtlinge oder Migranten involviert sind, wurden maßlos aufgebauscht, oft schlicht erlogen. Aber sie sind die Basis für eine Hetzkampagne in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Rechte Gruppen bedienen sich in äußerst effizienter Weise der sozialen Medien und sind dabei, ein Paralleluniversum zu schaffen. Auf diese Weise werden Angstgefühle und Frusterlebnisse, die nicht nur mit Flüchtlingen zu tun haben in einen politischen Erklärungsrahmen gesetzt. Flüchtlinge werden zu Invasoren, die das Abendland muslimisieren wollen und die persönliche Lebensplanung der Verängstigten gefährden. Und es gibt nicht nur Sündenböcke, sondern auch Schuldige. Jene, die die Invasoren leichtgläubig oder absichtlich eingeladen hätten. Die eigenen Leute wären schuld. Eine vom „System“ geförderte Willkommenskultur hätte die Menschen dazu verführt, nach Europa zu flüchten. Die Bundeskanzlerin selbst hätte sich in unerträglicher Weise an die Spitze gestellt und mit provokativen Selfies die Fluchtbewegung in Gang gesetzt. Daher wäre es an der Zeit, sie vom hohen Thron zu stürzen. So ungefähr klingt das.
In einem Klima, das Menschen nur mehr als Angehörige von Gruppen, denen man bestimmte Eigenschaften zuschreibt, sieht gelten individuelle Eigenschaften nichts. Menschenrechte werden überflüssig. Mitleid oder persönliche Betroffenheit werden als naive Gefühlsduselei von „Gutmenschen“ denunziert.
Aber wie war es wirklich?
Schuld am Flüchtlingszustrom wäre also die Willkommenskultur, die Menschen geradezu animiert worden, nach Europa zu kommen. Ein Blick auf die Chronologie der Ereignisse widerlegt das, was mittlerweile die Mehrheit der Menschen glaubt. Merkels berühmtes Selfie wurde am 10. September aufgenommen, die Grenzöffnung geschah am 4. September und der Flüchtlingsstrom hatte bereits im Juli deutlich zugenommen, besonders seit sich die Nachricht von der Errichtung des ungarischen Grenzzauns zu Serbien verbreitete. Ich habe das immer wieder von den Flüchtenden gehört, als ich Ende August 2015 die Balkanroute bereiste.
Natürlich gab es Pull-Faktoren. Aber das lässt sich nicht so erklären, wie es die selbst erklärten Retter des Abendlandes möchten. Denn, je mehr Menschen nach Deutschland kamen, umso mehr verbreiteten sich dank der sozialen Medien die Kenntnisse über mögliche Fluchtwege und Fluchtziele. Gewissermaßen die erste digitale Fluchtbewegung, ähnlich dem arabischen Frühling, der so was wie die erste Facebook-Revolution darstellte.
Um zu verstehen, was in diesem Sommer 2015 passierte, muss man die Push-Faktoren heranziehen. Nach dem Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien (2011) war die überwältigende Mehrheit der Geflüchteten und Vertriebenen fast vier Jahre lang in unmittelbarer Nähe ihrer Heimat verblieben. Weil sie hofften, bald wieder zurückkehren zu können.
Drei Faktoren waren ausschlaggebend, warum sich das plötzlich änderte.
Zum einen der ab Sommer 2014 einsetzende Vormarsch der IS-Terroristen, der vor allem den Nordirak (Niniveh, Sinjar) und Syrien (Raqqa, Rojava) in Schrecken versetzte und hunderttausende Verfolgte unterschiedlicher ethnischer und religiöser Minderheiten in die Flucht trieb. Zum anderen die zunehmende Aussichtslosigkeit eines schnellen Friedens in der Region, die sich mit dem Beginn des russischen Engagements in Syrien deutlich abzeichnete. Den entscheidenden Ausschlag allerdings gab ein schwerwiegender Fehler, der sich ohne weiteres hätte vermeiden lassen. Schon seit Anfang 2015 hatte die internationale Gemeinschaft immer wieder auf den drohenden Kollaps der seit langem chronisch unterfinanzierten Versorgungsstrukturen in den Lagern im Libanon und im Nordirak hingewiesen. Niemand wollte diese Rufe hören. Am Beginn des Flüchtlingstrecks stand eine Reduktion der durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen von 28$ pro Flüchtling auf 13$. Diese Differenz erklärt wohl mehr als Merkels Selfie.
Die fatalen Auswirkungen notorischer Ignoranz
Die Flüchtlingskrise ist Ausdruck eines systematischen, multikausalen Politikversagens. Die Flüchtenden wurden erst dann wahrgenommen, als sie bereits in großer Zahl bei uns angekommen waren. Nur wenige hatten sich Gedanken darüber gemacht, was sich da schon lange angekündigt hatte. Migration, Flucht und Vertreibung, im etablierten Politikbetrieb der Staatskanzleien waren Randthemen, die man besser nicht anrühren sollte und schon gar nicht „Brüssel“ überlassen sollte. Die Formulierung einer einheitlichen europäischen Zuwanderungspolitik oder die Reform des Dublin-Systems, von dem niemand jemals wirklich überzeugt war, wurden auf die lange Bank geschoben. Nur nichts Neues wagen und einfach weitermachen, als ob es keine Probleme gäbe. Augen zu.
Migration und Zuwanderung blieb im Prinzip der nationalen Kompetenz überlassen und damit dem Kalkül nationaler Innenpolitik. Kurzfristige und partikulare Interessen dominierten. Kleinkariertheit, Engstirnigkeit und provinzielle Kirchturmpolitik sind freilich die besten Voraussetzungen für kolossales Scheitern. Das sollte sich in jenem denkwürdigen Sommer 2015 auch weisen.
Es war schäbige Knausrigkeit, die den größten Flüchtlingsstrom seit dem Zweiten Weltkrieg in Gang setzte. Die visionäre Energie der europäischen Staatskanzleien erschöpfte sich darin Einsparungen durchzusetzen, wo es das Wahlvolk nicht unmittelbar spürt. Wie etwa bei der Finanzierung internationaler Hilfsprogramme. In diesem Punkt ist Kritik an Merkel angebracht. Sie gestand den Fehler wenigstens ein: „Wir haben alle…ich schließe mich da ein, nicht gesehen, dass die internationalen Programme nicht ausreichend finanziert sind, dass Menschen hungern in den Flüchtlingslagern, dass die Lebensmittelrationen gekürzt wurden.“
Diese Aussage machte sie anlässlich des EU-Flüchtlingsgipfels am 25. September des Vorjahrs. Damals wurde übrigens eine Milliarde Euro Unterstützung für Syrienflüchtlinge vereinbart. Geflossen ist freilich erst ein Bruchteil.
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben
Auch ein Jahr danach hat sich nicht wirklich etwas verändert, wie dieses Beispiel zeigt, auch wenn der Zustrom dank des (unmoralischen) Türkei-Deals deutlich zurückgegangen ist.
Die Errichtung von Grenzzäunen innerhalb Europas, in Ungarn und in Mazedonien hat kriminellen Schlepperbanden Rekordeinkünfte beschert. 19.000 Menschen sind allein nach der Schließung der griechisch-mazedonischen Grenze im März über Ungarn nach Österreich und Deutschland gelangt. Jene, die das Geld nicht aufbringen können, bleiben im Norden Griechenlands oder irgendwo dazwischen hängen. Unter unvorstellbaren Bedingungen. Gelingt es nicht bald, einen großen Teil dieser Menschen in Europa zu verteilen, droht nicht nur eine menschliche Katastrophe, sondern auch eine Destabilisierung Griechenlands. Vor allem würde das europäische Projekt nachhaltigen Schaden erleiden. Dabei geht es nicht so sehr um den illiberalen Block der Visegrád-Staaten. Es würde reichen, wenn die „willigen“ Mitgliedsstaaten beginnen, ihre Zusagen einzuhalten. Erste hoffnungsvolle Ansätze gibt es mit Portugal.
Auch wenn alle Flüchtlinge aus Griechenland und Italien verteilt und der Zustrom auf eine handhabbare Größe reduziert wäre, ist das Problem nicht einmal annähernd gelöst. Es muss sehr rasch, sehr viel mehr für die Integration der in Europa befindlichen Menschen unternommen werden. Vor allem müssen die Asylverfahren zügig und menschenrechtskonform abgewickelt werden. Das ist primäre Angelegenheit der Mitgliedstaaten, aber es braucht einheitliche europäische Standards.
Lasst Europa tun, was es besser kann
Vor allem ist es notwendig, in und nahe den Herkunftsländern Verhältnisse zu schaffen, unter denen die Menschen bereit sind, dazubleiben oder zurückzukehren. Eine energischere, europäische Außenpolitik hätte in der Tat solche Bedingungen schaffen können. Wenn auch kein sofortiger Friedensschluss, dann zumindest ausverhandelte Sicherheitszonen wären im Bereich des Möglichen gewesen. Allerdings muss man das auch wollen und der Außenbeauftragten der EU das entsprechende Mandat erteilen. Das passierte nicht. Nationaler Egoismus, wohin man schaut, auch in der Außenpolitik.
Europa muss nicht nur in der Außenpolitik endlich mit einer Stimme sprechen.
Es muss dazu übergehen, legale Einreisemöglichkeiten für Geflüchtete und Vertriebene aus den von kriegerischen Auseinandersetzungen betroffenen Gebieten zu schaffen und ein langfristiges Konzept einer ganzheitlichen Migrationspolitik umsetzen.
Geredet wird ja viel darüber. Allein es fehlt an der Umsetzung. Aber nicht, weil es auf der europäischen Ebene keine Konzepte oder keinen politischen Gestaltungswillen gäbe. Kurzsichtigkeit, Kleingeistigkeit und nationalstaatliche Engstirnigkeit haben verhindert, dass es gemeinsame Kontrollen an den Schengen Außengrenzen gibt. Genauso trifft das auf die bisher immer wieder verschleppte Schaffung von Instrumenten legaler Zuwanderung zu. Die Blue Card ist ein erster, aber viel zu bescheiden geratener Ansatz. Man hatte sich auf keine wesentliche Reform einigen können, weil die Angst vor Zuwanderung den Blick verstellt. Vor allem bei jenen Ländern, die von der Arbeitnehmerfreizügigkeit des Binnenmarktes profitieren. Diese schüren aus innenpolitischen Gründen Ängste vor allem Fremden. Die gegenwärtige abstruse Kampagne des Orbán Regimes zeigt das. Gerade dieser Puszta-Putin, aus dessen Land mehr als 600.000 Arbeitskräfte irgendwo im Westen Europas arbeiten, müsste das wissen:
Migration ist kein Phänomen unserer Tage. Seit es Menschen gibt, wandern sie ein und aus. Relativ neu ist, dass Europa zu einem Einwanderungsziel wurde. Vor einer Generation war das noch umgekehrt. Das spricht zunächst einmal für die Attraktivität des europäischen Modells. Migration wird von Push- und Pull-Faktoren bestimmt. Im Idealfall bedingen sie sich wechselseitig. Es gibt viele Gründe, warum Staaten Zuwanderung positiv sehen sollten. Erfolgreiche Nationen tun dies ja auch. Zumeist sind das wirtschaftliche Gründe. Im Fall Europas auch demografische. Das ist historisch betrachtet tatsächlich neu.
Es gibt aber nicht nur erwünschte Migration. Oft ist sie erzwungen. Menschen müssen aus wirtschaftlichen Gründen (bald wahrscheinlich auch wegen der Klimaerwärmung) ihre Heimat verlassen. Gerade im Falle Afrikas sind diese Push-Faktoren wirksam und zumeist Resultat verantwortungsloser Politik: Nicht nur lokalen Faktoren, sondern vor allem der EU-Handelspolitik und einer ungenügenden Entwicklungspolitik geschuldet. In den Griff bekommen kann man das allerdings nur, wenn Europa gemeinsam auftritt. Was sollte da ein Staat wie Österreich alleine ausrichten.
Das gilt auch für die Lösung der Flüchtlingsfrage. Als einzige Möglichkeit wird im Moment das Asylverfahren strapaziert. Überstrapaziert. Weil es nie dafür gedacht war. Weil sich Europa zu keiner einheitlichen Migrationspolitik durchringen konnte, wurde das Asylverfahren zum einzigen Ventil für Zuwanderung. Dafür war es allerdings niemals gedacht. Entstanden aus den Erfahrungen mit Krieg und Faschismus sollte es politisch Verfolgten Schutz und Asyl bieten. Aber nicht einmal zu einer einheitlichen europäischen Asylpolitik konnte man sich durchringen. Das Dublin-Regime, wonach der jeweilige Ersteintritt in den Schengen-Raum entscheidend ist, verschob das Problem an die Peripherie Europas. Es scherte niemanden, dass es nicht funktionierte. Hauptsache der vor ökonomischer Kraft strotzende Norden war davon nicht betroffen. Schwierig wurde es erst, als im Sommer 2015 immer mehr Kriegsflüchtlinge über Griechenland nach Europa gelangten. Dieses Land war schon vor der Fluchtbewegung des Sommers 2015 völlig überfordert. Wieso sollte es ausgerechnet diese Belastungen meistern können? Griechenland war kaputtgespart und gedemütigt.
Was wäre gewesen, wenn
Jetzt rächte sich, dass man jahrzehntelang aus purem Eigennutz die Augen verschlossen hatte. Angela Merkel war eine der wenigen, die diese Fehler selbstkritisch eingestanden hat. Wenngleich auch zu einem Zeitpunkt, wo sich das Rad der Geschichte nicht mehr rückgängig machen ließ: Die heraufziehende Flüchtlingskrise sei „zu lange ignoriert“ und die „Notwendigkeit einer gesamteuropäischen Lösung verdrängt“ worden.
Zu einer gesamteuropäischen Lösung hätte auch gehört, dass man schon frühzeitig hätte beginnen müssen, Flüchtlinge und Vertriebene kontingentweise aufzunehmen und die internationale Gemeinschaft in die Pflicht zu nehmen. So wie das immer wieder passierte. Wie etwa beim Bosnienkrieg. Einen Rechtsrahmen für ein solches Resettlement-Programm wäre auch schon vorhanden gewesen, die sogenannte Massenzustromrichtlinie. Man hätte sie nur reaktivieren müssen. Ich habe bereits im September 2013 – damals waren erst 60.000 Syrien Flüchtlinge im Schengen Raum – darauf hingewiesen, dass die EU eine moralische Verpflichtung hätte angesichts der sich zuspitzenden Situation zu handeln und ein gesamteuropäisches Resettlement – Programm gefordert, um die Aufnahme von Kontingentflüchtlingen zu ermöglichen. Außer ein paar Dutzend „likes” auf Facebook gab es keine Reaktionen, obwohl ich mich intensiv um Resonanz bemühte.
Mir geht es nicht darum, recht gehabt zu haben. Aber mein Beispiel zeigt, dass es Alternativen gab und es einfach nicht stimmt, dass Europa versagt hat. Es waren die Nationalstaaten, die nicht zuließen, dass Europa aktiv wird. Im Übrigen die gleichen, die jetzt beklagen, die EU hätte versagt. Auf jeden Fall wäre uns vieles erspart geblieben. Europa hätte Handlungskompetenz bewiesen und wäre von den Menschen als politischer Faktor wahrgenommen worden und nicht als hilfloser Papiertiger.
In der letzten Woche war ich wieder einmal in Nordgriechenland, in der Gegend um Idomeni. Dort ist es ruhig geworden. Auf den ersten Blick hat der Grenzzaun etwas Definitives bewirkt. Keine Menschenmassen mehr, die hoffen hier durchzukommen. Das (informelle) Lager, wie wir es aus den Medien kennen, ist aufgelöst, die Menschen auf andere Camps aufgeteilt. Die abschreckenden Bilder sind verschwunden und damit auch das Interesse der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit lokal Verantwortlichen, Bürgermeistern und Gemeinderäten habe ich die beiden Auffanglager Nea Kavala (Polykastro) und Cherso (Kilkis) besucht. Äußerst engagierte und bemühte Menschen mit viel Empathie, aber auch verzweifelt, ob der Aussichtslosigkeit der Situation. Fast ausnahmslos sind sie Nachkommen von Flüchtlingen, die in den 1920er Jahren in dieser während der Balkankriege verwüsteten Gegend angesiedelt wurden. Pontosgriechen, kappadokische und rumelische Griechen sowie Vlachen. Die Erinnerung an Flucht, Vertreibung und Verfolgung der Großeltern ist noch immer präsent. Sie hat die Menschen nicht verhärtet. Sie hat sie sensibel gemacht für die Not anderer.
Die Gemeindekassen sind wegen der Wirtschaftskrise leer, es mangelt an allem. Weder Verbandsmaterial noch Medikamente sind vorhanden. Trotzdem haben die Menschen geholfen und sie wollen weiter helfen. Doch die Mittel der EU, die Griechenland zur Verfügung gestellt bekommt, sind von den Athener Zentralstellen bereits verplant. Nach Angaben des Bürgermeisters von Samos sind gerade einmal 4,2 Millionen Euro in den Gemeindebudgets gelandet. Von den NGOs, die sich während der Wochen, in der die ganze Aufmerksamkeit auf die Region gelenkt war, buchstäblich auf die Füße traten, sind nur wenige geblieben. Sie sind in Athen, Saloniki und Lesbos. Ihre Aktivitäten sprechen sie nicht mit den lokalen Behörden ab, vieles läuft unkoordiniert. Ohne das griechische Militär würde in den beiden Lagern gar nichts funktionieren. Die Situation ist deprimierend. So begehrenswert die griechische Sonne für Touristen ist, für Flüchtlinge ist sie ein Alptraum. Gnadenlos heizt sie die 350 Zelte auf. Wie viele Menschen es tatsächlich sind, die in diesem Lager dahinvegetieren – anders kann man das nicht nennen – ist schwer abzuschätzen. 4000 Menschen wurden hier von den griechischen Behörden registriert. Es dürften sich aber deutlich weniger Menschen am Gelände aufhalten. Am Tag meines Besuchs wurden 1800 Mahlzeiten ausgegeben. Auf meine Frage, wie man diese Differenz erklären könnte, zeigte der mich begleitende Verantwortliche auf die nahen Berge, die die Grenze zu Mazedonien/FYROM markieren. Hier gibt es keinen Grenzzaun und es gilt lediglich genug Geld zu haben, um bei Kontrollen im Nachbarland durchgelassen zu werden. Schlepper verlangen für die Passage an die österreichisch – ungarische Grenze um die 1.500 €. Übrig bleibt also, wer kein Geld hat und wer körperlich beeinträchtigt ist. Das sind viele.
Die Menschen bestürmen mich. Sie wollen, dass ich ihre Gesundheitsatteste fotografiere. Alle brauchen sie Medikamente. Vieles davon ist nicht vorhanden. Rollstühle, auf die nicht wenige angewiesen sind, sind zumeist in defektem Zustand. Viele Flüchtlinge, vor allem Männer wurden während der Kriegshandlungen verletzt. Ein Mann aus Nordsyrien will meine Mail Adresse. Am Abend wird er mir Bilder seiner getöteten Familie senden und eines, auf dem er blutüberströmt aus den Trümmern gezogen wird.
Eine Frau, die mit ihren fünf Kindern im Lager lebt, bittet mich bei der deutschen Botschaft in Athen zu intervenieren. Fein säuberlich hat sie ihre Dokumente in einer Mappe geordnet. Ihr Mann hat bereits in Deutschland Asyl erhalten. Nun hofft sie auf Familienzusammenführung. Der Termin, für ihre Anhörung in Athen liegt in weiter Ferne. Erst im Dezember ist es so weit. „Was soll ich hier machen?“, fragt sie mich. „Meine Kinder gehen nicht zur Schule und wissen nicht, was sie den ganzen Tag tun sollen.“ Glücklicherweise gibt es ein Programm von „Save the Children“ das freilich nicht den regulären Schulunterricht ersetzen kann. Kinder sieht man überall. Neugierig und kontaktfreudig. Viele von ihnen kennen noch nicht die Verbitterung, die einem entgegenschlägt, wenn man mit den älteren Männern im Lager redet. Ich habe mich mit einer Gruppe von Wortführern zurückgezogen. Sie reden auf mich ein. Immer wieder sagen sie: „Wann kommen wir da raus? Sag uns bitte ein Datum.“ Ich kann ihnen keine Antwort geben. Das wollen sie nicht zur Kenntnis nehmen, auch nicht meine Beteuerung, dafür nicht zuständig zu sein. „Wir wollen mit den Zuständigen reden. Wir sind hier gefangen und werden hier zugrunde gehen. Die, die Geld haben sind schon längst weg.“ Lang geht es so dahin. Dann steht ein Mann auf und drückt mir ein Baby in die Hand: „Nimm wenigstens die Babys mit. Die sollen zumindest eine Chance haben.“
Ja, die Babys. Alle fürchten sich vor dem heißen August. Dann wird es unerträglich werden in den Plastikzelten. Auf dem ganzen Areal gibt es lediglich 20 Duschen. Eine Gemeinderätin meint: „Wenn wir wenigstens in dieser Zeit die Babys und die Schwangeren in Häusern unterbringen könnten. Wir werden es versuchen, aber wer wird für die Kosten aufkommen?“ Gegenwärtig befinden sich 50 Babys (jünger als ein Jahr) und fünfzehn schwangere Frauen im Camp.
Die Situation ist explosiv. Immer wieder gibt es Berichte von tätlichen Auseinandersetzungen im Camp. In einem ruhigen Moment zieht mich ein Mann zur Seite. Er erzählt mir, in letzter Zeit hätten sich radikale IS-Aktivisten gezeigt. Er habe große Angst, dass sie Einfluss auf die Lagerbewohner gewinnen könnten. In Nea Kavala, das in Blickweite des Grenzzauns von Idomeni liegt, scheint dies bereits der Fall zu sein. Ich habe mich mit den Vertretern der Jesiden getroffen. Sie berichten mir von tätlichen Übergriffen. Unlängst hätten sich Daesh Aktivisten nachts ins Zelt geschlichen und die Bewohner mit Messern bedroht. Begonnen hätten die Insultationen schon während des Ramadan, als radikale Islamisten forderten, dass sich die Jesiden an das Fastengebot hielten. Mittlerweile sei das Klima im Lager total vergiftet und die Frauen hätten Angst alleine zum Einkaufen in das naheliegende Polykastro zu gehen. Der uns begleitende Polizist bestätigt, dass die Ängste nicht unberechtigt sind.
Die Jesiden, deren gegenwärtiges Leiden am 3. August 2014 mit der Vertreibung aus ihren angestammten Regionen in der Nineveh-Ebene und im Sinjar Gebirge begonnen hat, sind am meisten benachteiligt. Fast 5000 hängen in Griechenland fest, 470 allein in diesem Lager. Überall kommt es zu Übergriffen. Ich habe ihnen versichert, alles zu tun, damit sie möglichst rasch im Rahmen des langsam in die Gänge kommenden Umsiedelungsprogramms der EU aus dieser doppelten Notlage befreit werden. Die portugiesische Regierung ist grundsätzlich dazu bereit, einige Tausend aufzunehmen. Leider mahlen die Mühlen der europäischen Kooperation sehr langsam, beschämend langsam. In solchen Situationen spürt man die Wut in sich hochkommen. Sie wird mich antreiben in den nächsten Wochen. Nicht indem ich mich in den Chor derjenigen einreihe, die tagtäglich herunterbeten, wer und was nicht funktioniert, ohne aber auch nur irgendwie zu versuchen selbst Lösungen anzubieten. Ich will dazu beitragen, dass der Umsiedlungsprozess (Relocation) aus Griechenland endlich startet und die Jesiden nicht vergessen werden. Ja, es braucht Ausdauer und einen starken Willen.
Eine Szene aus Nea Kavala lässt mich nicht los. Ein Jeside, etwas jünger als ich lädt mich in sein Zelt. Stolz zeigt er mir „die Mutter“. Ob es seine Mutter ist, bleibt ebenso unklar wie ihr genaues Alter. Mit Sicherheit ist sie über 100 Jahre alt. Er hat sie vom Nordirak bis nach Griechenland getragen – auf seinem Rücken. Auf meine Frage, ob das nicht anstrengend gewesen sei, meint er: „Ja schon, aber ich wollte nicht, dass sie alleine stirbt.“ Ich sitze eine Zeit lang neben ihr, sie ergreift meine Hand, erzählt mir, dass sie blind sei, aber glücklich, nicht von ihrer Familie zurückgelassen worden zu sein.“
Ich bin ziemlich aufgewühlt und recht pessimistisch nach Österreich zurückgekehrt. So kann es mit Sicherheit nicht weitergehen. Spätestens im Winter wird die Situation in den Lagern explodieren. So wie es aussieht, wird Griechenland mit der Situation nicht fertig werden. Wer sich nicht damit abfinden will, Jahre in einer solch unerträglichen Situation dahinzuvegetieren, wird alles daran setzen, wegzukommen. Da nützen auch keine Zäune. Das sind nur populistische Beruhigungspillen für das heimische Publikum. Jeder neue Zaun lässt die Kassen der Schlepper klingeln. Je wichtiger das Schlepperwesen, desto größer die organisierte Kriminalität. Nicht unlogisch. Schon jetzt gibt es Berichte über Menschen- und Organhandel. Der „Relocation“-Prozess müsste dringend einsetzen. Im Prinzip sind die Voraussetzungen erfüllt. Der Registrierungsprozess, der nur schwer in Gang gekommen ist, ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Und es gibt Regierungen, die bereit sind Flüchtlinge aufzunehmen. Nicht nur Portugal. Man müsste das nur offensiv mit europäischer Assistenz angehen. Hier ist die Kommission einiges schuldig geblieben.
Das große Fragezeichen ist freilich, was nun in der Ägäis passieren wird. Niemand weiß es. Fast täglich checke ich die Zahlen. Im Juli waren es im Tagesschnitt um die 20 „New Arrivals“. Seit dem Militärputsch beginnt die Zahl wieder zu steigen. Am 2. August waren es beispielsweise 109. Sollte sich dieser Trend verfestigen, dann wird in Griechenland, das seit Mitte Juni niemand mehr in die Türkei zurückschickt, die Zahl der Flüchtlinge drastisch steigen. Die Spannungen in den Lagern werden zunehmen und auch die Konflikte mit der lokalen Bevölkerung. Manche Orte, wie Polykastro klagen, dass es wegen der Unterbringung der Flüchtlinge zu Wasserknappheit gekommen ist. Ja, es muss etwas geschehen: rasch, zielgerichtet und pragmatisch. Passiert das nicht, dann wird Griechenland ein großes Nauru, ein permanentes Zwischenlager für alle, die das mit Grenzzäunen sich selbst zerstörende Europa fernhalten will. Mit unabsehbaren Folgen.
PS: Just zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Bericht sharen will, erreichen mich dramatische Nachrichten von meinen jesidischen Freunden aus Nea Kavala. Am zweiten Jahrestag des Genozids wurden sie im Lager überfallen und mit der Ermordung bedroht. Sie konnten auf ein freies Feld flüchten und wurden nach Stunden in der prallen Sonne in ein neues noch nicht fertiggestelltes Camp überstellt, in das auch Jesiden aus anderen Lagern gebracht werden sollen.
Ich habe nicht mit dem Brexit gerechnet. Genauso wenig wie meine Kolleginnen und Kollegen von der Labour Party. Unsere Büros sind (oder soll ich schon sagen: waren) nebeneinander im 13. Stock des Europaparlaments. In den letzten beiden Wochen war es ganz leer am Gang geworden. Alle waren in ihren Wahlkreisen. Am Einsatz konnte es nicht gelegen sein. Alle waren motiviert, weil sie wussten, was auf dem Spiel stand. Die Befürchtung war immer vorhanden, dass es am Ende nicht reichen würde. Jeden Tag und bei jedem Gespräch. Aber irgendwie hatten wir darauf vertraut, dass nicht geschehen könne, was nicht geschehen darf.
Die Entscheidung des britischen Volkes wird weitreichende Folgen haben. Da geht es um sehr viel mehr als um den Austritt eines Mitgliedsstaates. Was gestern passierte, das kann in der Folge überall passieren und überall wird es die gleiche Botschaft sein: alleine können wir es besser. Mitnichten. Aber das interessiert ja die Nationalisten, deren Horizont über ihren Wahlkreis kaum hinausreicht, nicht. Sie sichern so ihr politisches Überleben, so wie im Fall des Brexit Boris Johnson oder Nigel Farage. Jahrzehntelang hatten sie darauf verzichtet, konstruktive Kritik zu betreiben. Vielmehr lebten sie ganz gut davon, alles schlecht zu reden. Johnson als langjähriger Brüssel Korrespondent des Daily Telegraph. Er war bekannt für seine Übertreibungen und trug maßgeblich zum negativen Image der EU- Institutionen bei. Lange zögerte er, ob er für oder gegen den Brexit sein sollte. Als er die Chance sah, dass er David Cameron ablösen könne ergriff er sie. Er war das Gesicht der Austrittskampagne. Mit Nigel Farage allein wäre das Ergebnis wohl anders ausgefallen. Er ist ein arroganter Exzentriker, der sich seit 1999 vom Europaparlament finanzieren lässt und einer unser faulsten Abgeordneten. Ich sitze ihm gegenüber, daher weiss ich das. Er benutzt Europa, um es zu zerstören. Solche Typen gibt es viele, viel zu viele. Und ich traue etlichen Kollegen zu, Ähnliches wie den Brexit im eigenen Mitgliedsstaat loszutreten.
Die nächsten Jahre werden nicht leicht. Vieles hat diese EU ausgehalten und ist dabei zumeist stärker geworden. Aber das jetzt? Der Brexit könnte sogar ihr Todesstoß gewesen sein. Seit einiger Zeit trage ich den Gedanken mit mir herum, ob die EU nicht ein ähnliches Schicksal wie Jugoslawien treffen könnte. Ich weiss, dass Vergleiche hinken. Zwar war Jugoslawien keine Demokratie, allenfalls auf dem Weg dorthin. Aber es war ein gemeinsamer Lebensraum mit einem gemeinsamen Binnenmarkt. Zusammen hatten die jugoslawischen Völker auch Gewicht auf der internationalen Bühne. Ziemlich auf den Tag genau vor 25 Jahren begann die Auflösung Jugoslawiens mit allen bekannten Konsequenzen: Bürgerkrieg, Genozid und Vertreibung. Der Zusammenbruchs des Binnenmarktes führte zu gravierenden Wohlstandsverlusten von denen sich die Region bis heute nicht erholt hat.
Vor 25 Jahren da haben viele Menschen in Österreich – ich gehörte auch dazu-
die Unabhängigkeitsbestrebungen im ehemaligen Jugoslawien begrüßt. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, was da alles wenige Jahre später passieren sollte. Dieser Prozess lässt sich auch nicht rückgängig machen. Feststeht nur, dass ohne eine europäische Perspektive die Situation in der Region um vieles trister wäre. Und die Lage ist wirklich trist. Ich fürchte mich davor, dass aus EU-rope in nicht allzu ferner Zukunft YU-rope werden könnte. Ein YU-rope Szenario, das wäre die Katastrophe des 21. Jahrhunderts. Noch sind wir weit davon entfernt, aber wir müssen auf der Hut sein. Was es jetzt sofort braucht sind kluge und wohl überlegte Massnahmen. Ohne Zweideutigkeit. Genau das fehlte in den Neunziger Jahren im ehemaligen Jugoslawien. Damals schlug die Stunde der nationalistischen Vereinfacher, der Hetzer und Maulhelden. Die Besonnenen waren zu leise und die Reformer zu wenig mutig.
Wenn, wann nicht jetzt sollten wir uns daran machen, für ein anderes, ein besseres Europa zu kämpfen. Das Europäische Parlament wird bereits am Dienstag zu einer außerordentlichen Plenarversammlung zusammentreten. Es werden außerordentliche Massnahmen diskutiert werden. Alle wissen wir, dass es so nicht weitergehen kann. Mit dem Europa a la carte, wo sich Unternehmen aussuchen können, wo sie Steuern zahlen. Schluss mit Steuer und Lohndumping und Schluss mit einer unsolidarischen Migrationspolitik, wo die einen sich weigern, Flüchtlinge aufzunehmen und die anderen Zäune hochziehen. Wir brauchen ein mutiges Reformprojekt, wo sich die Menschen wiederfinden. Keine Halbheiten mehr. Deswegen wird es sehr bald einen Reformkonvent geben müssen, der die notwendigen Beschlüsse einleiten muss. Wir haben keine Zeit zu verlieren und die S&D Fraktion ist auf diese Aufgabe vorbereitet. Wir werden schon am Dienstag die entsprechenden Vorschläge einbringen.
Zu manchen Ländern entwickelt man im Lauf des Lebens eine besondere Beziehung. Für mich ist Kambodscha ganz vorne. Das wurde mir wieder bewusst, als ich am Ende eines USA-Besuchs meinen Freund Daran Kravanh traf. Er lebt im kalifornischen Exil und kämpft für eine demokratische Zukunft seiner Heimat. Mit mäßigem Erfolg, aber mit großem Einsatz und dem Charme seiner Persönlichkeit. So wie damals, als er den „Killing Fields“ der Roten Khmer entkommen konnte, weil er ein begnadeter Musiker ist. Eigentlich hätte ich ihn in Phnom Penh treffen sollen, doch da war er sich seines Lebens nicht sicher.
Eine ganze Woche war ich unlängst in Kambodscha. Als Leiter einer Mission des Europäischen Parlaments. Unter meiner Leitung haben sieben Parlamentarier die prekäre Situation der Menschenrechte ins Visier genommen. Im Zentrum: systematische Behinderungen der Opposition und gezielte Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Die Korruption ist allgegenwärtig und die Unabhängigkeit der Justiz besteht oft nur am Papier. Der Spielraum von Gewerkschaften und NGOs wird neuerdings gezielt reduziert. Die Kommunalwahlen (2017) und die Parlamentswahlen (2018) werfen bereits jetzt ihre Schatten voraus. Erstmals seit dreißig Jahren könnte es zu einem Machtwechsel kommen. Die Regierenden sind nervös. Die Opposition, angeführt von Sam Rainsy und Khem Sokha ist voller Hoffnung. Berechtigt. Sie ist in der Lage die Menschen zu mobilisieren, vor allem dank der sozialen Medien.
Kambodscha beschäftigt mich seit dem Ende des Vietnamkriegs. Als die Roten Khmer, eine ideologisch verblendete Terrorgang die Macht übernahmen. Die Nachricht von deren systematischem Morden hatte mich damals schwer verunsichert. Alles was als dekadent und bürgerlich galt oder dem Willen der neuen Machthaber, eine neue Gesellschaft aus dem Boden zu stampfen, im Wege stand, wurde ermordet. Nach fünf Jahren Schreckensherrschaft waren das zwei Millionen Menschen, mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Unvorstellbar war für mich damals auch, dass es in meinem linken Umfeld viele gab, die diese Verbrechen tolerierten, sie entschuldigten oder gar als notwendig betrachteten. Ich habe mich damals gefragt, ob der Terror der Khmer Rouge den Sozialismus zu seiner Unkenntlichkeit verzerrt oder zu seiner Kenntlichkeit gebracht hat. Für mich war bald klar, dass diese Vorgänge mit einem linken Weltbild unvereinbar sind. Ohne Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte kann es keine gerechte Gesellschaft geben. Basta.
In meiner Heimat Oberösterreich gibt es eine große kambodschanische Community. Über 2000, den Gräueltaten der Khmer Rouge entkommene Menschen leben heute hier. Bestens integriert und natürlich nach wie vor an den Vorgängen in Kambodscha interessiert. Der Kontakt zu ihnen bedeutet mir viel. Wir haben gemeinsame Kampagnen gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in der kambodschanischen Textilindustrie durchgeführt und uns für die Opposition eingesetzt. Hier habe ich auch Sam Rainsy, seine Frau Tioulong Saumura und Khem Sokha kennengelernt. Im letzten EU-Wahlkampf wurde ich von der kambodschanischen Community mit großer Begeisterung unterstützt.
Auch deshalb setze ich mich im Europaparlament immer wieder für Kambodscha ein. Mit dringlichen Resolutionen im Plenum oder im Menschenrechtsausschuss. Kambodscha hat sich erstaunlich entwickelt. Alle, die das Leid auf den „Killing Fields“ er-und überlebten, hätten sich das niemals vorstellen können. Das Land gehört zu den „Emerging Economies“ und verändert sich rasant. Sogar die notorisch hohe Armut nimmt erstmals ab. War vor zehn Jahren noch die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsschwelle, so sind das gegenwärtig nur mehr 20 %. Zukunft scheint möglich. Erstmals seit Langem. Hun Sen, der schillernde, seit Jahrzehnten im Amt befindliche Machthaber beansprucht, dieses kleine Wirtschaftswunder herbeigeführt zu haben. Von Selbstzweifeln ist er nicht geplagt. Der historischen Wahrheit näher kommt die Feststellung, dass er klug genug war, den Aufschwung zuzulassen. So wie in der Nachkriegszeit damals bei uns war die Tüchtigkeit und der Optimismus der einfachen Menschen ausschlaggebend. Hun Sen hat weniger Fehler gemacht, als Putin, Erdogan, Alijew oder Orbán. So wie diese ist er von wirtschaftlichen Interessen getrieben. Wirtschaft heißt in diesem Zusammenhang in erster Linie Optimierung persönlichen Reichtums. Die Korruption ist allgegenwärtig und zersetzt alle Bemühungen rechtsstaatliche Bedingungen aufrechtzuerhalten. Klientelismus sorgt für Abhängigkeit und sichert den Machterhalt. Alles, was nicht dieser Primitivlogik entspricht und sich auf die Verwirklichung von Grundwerten beruft, wie Freiheit, Gerechtigkeit oder Solidarität, wird als gefährlich eingestuft: NGOs und Gewerkschaften, unabhängige Medien und vor allem die Opposition.
Leider sind wir uns bisher nie persönlich begegnet. Das ist eigentlich ungewöhnlich. In einem kleinen Land wie Österreich läuft man sich unwillkürlich irgendwann einmal über den Weg. Vor allem, wenn man politisch unterwegs ist. Schade darum, aber war halt so. Ich hätte mit Ihnen gerne darüber geredet, wie es kommen konnte, dass die von Bruno Kreisky losgetretene Aufbruchsstimmung sich einfach auflösen konnte. Wie so viele in den 1970er Jahren standen wir im Bann seiner Sozialdemokratie und waren bereit öffentlich aktiv zu werden. Fast alle wurden wir enttäuscht, zogen uns zurück, ließen die SPÖ rechts liegen. Jeder auf seine Weise. Sie haben irgendwann Ihren Mitgliedsbeitrag nicht mehr einbezahlt. Hätte mir auch passieren können, wenn ich nicht in einer rebellischen Sektion gelandet wäre. So habe ich mich damals entschlossen, in der SPÖ für die Ideale des „Alten“, wie wir ihn bald nannten, zu kämpfen. Interessiert hat das niemanden. Egal ob jemand seinen Mitgliedsbeitrag nicht mehr bezahlte oder ob man in der Partei mittun wollte. Mit verächtlicher Selbstgefälligkeit strafte man alle, die nicht zum Kreis der Auserlesenen gehörten.
Wären wir uns damals begegnet, hätten wir wahrscheinlich darüber geredet, warum es zwischen jenen, die später bei Rot und Grün Spitzenpositionen einnehmen sollten, kaum eine Gesprächsbasis gab. Viele Funktionäre der jungen Grünen kamen aus unserem gemeinsamen Umfeld. Karl Öllinger und Peter Pilz kannte ich aus dem VSStÖ. Letzterer hat Sie für die Grünen angeworben. Recht hat er gehabt. Er hat eine gute Wahl getroffen. Oft frage ich mich, warum es in Österreich im Gegensatz zu Deutschland niemals ein rot-grünes Projekt gegeben hat. Nicht einmal nach 2000, als die SPÖ von Schwarz-Blau aus der politischen Verantwortung gedrängt wurde und es notwendig war, eine klare Alternative aufzuzeigen. Wiederum war es hochmütige Selbstgefälligkeit, zu glauben man könne die Wende aus eigener Kraft schaffen. Dieser Hochmut rächte sich. 2003 wäre es fast zu Schwarz-Grün gekommen. Das wurmt mich noch heute. Und vor allem das in diesem Zusammenhang stehende Experiment in meiner Heimat Oberösterreich. Doch so sehr das einem überzeugten Sozialdemokraten wehtut, wir hätten es selbst in der Hand gehabt, es zu verhindern, wären wir an einem ernsthaften Dialog von Rot und Grün interessiert gewesen. So viel Selbstkritik muss sein.
Sie haben damals Charakterstärke bewiesen, haben sich der Verantwortung für das Land nicht verwehrt und sich auch nicht verbogen, weil Sie am Ende der Verhandlungen mit Schüssel Ihre Prinzipien eben nicht über Bord geworfen haben. Außergewöhnliches Handeln in kritischen Situationen und dabei besonnen bleiben, das wird von einem Bundespräsidenten erwartet. Das haben Sie als Abgeordneter zum Nationalrat oftmals unter Beweis gestellt. Natürlich werde ich Sie am 22. Mai wählen. Aber nicht (nur) deswegen, weil ich Hofer verhindern will. Österreich braucht einen Präsidenten, der klar und unabhängig im Urteil ist, der nicht in verletzender Weise auftritt oder es gar auf die Spaltung der Bevölkerung anlegt. Ich bin überzeugt, dass meine Stimme bei Ihnen gut aufgehoben ist. Auf den künftigen Bundespräsidenten kommen wichtige Aufgaben zu. Österreich ist in einer dramatischen Situation. Trotz vergleichsweise guter Wirtschaftsdaten sind die Menschen unzufrieden und verunsichert. Das müsste eigentlich bei allen die Alarmglocken läuten lassen. Österreichs gegenwärtige Krise ist eine Krise der Institutionen. Als eine „Überbau“-Krise hätten wir sie in den 70er Jahren bezeichnet. Wir müssen die Glaubwürdigkeit unserer Institutionen wieder herstellen. Wir brauchen eine breite Diskussion über die Zukunft der Demokratie in unserem Land.
Von einem künftigen Bundespräsidenten erwarte ich mir, dass er eine solche Diskussion anstößt. Ich erwarte mir, dass Sie alle Anstrengungen unternehmen, den Österreichkonvent wieder zu beleben. Aber nicht als Beschäftigungstherapie wie vor zehn Jahren. Vielmehr müssen in verbindlicher Weise Reformen eingeleitet werden.
Fragen drängen sich viele auf:
- Wie können wir unsere Verfassung verbindlicher machen, indem wir ihr einen Grundrechtskatalog voranstellen und sie von allen taktischen Überfrachtungen befreien. In kaum einem Land wurden derartig viele, mit der Systematik der Verfassung nicht in Zusammenhang stehende Bestimmungen in den Verfassungsrang gehoben. Das hat unserer Demokratie nicht gut getan. Genau sowenig wie der zum Prinzip erhobene Klubzwang.
- Wie können wir zu einem funktionierenden Parlamentarismus kommen, bei dem das freie Mandat der Abgeordneten selbstverständlich ist und die Gewaltenteilung ernst genommen wird.
- Wie lässt sich die Unabhängigkeit der Rechtsprechung stärken und das Vertrauen der Menschen in die Exekutive verbessern.
- Und vor allem wie kann ein neues Verhältnis zwischen Bundesstaat und Ländern gefunden werden, um zu verhindern, dass egomane Landesfürsten, den Gesamtstaat in Geiselhaft nehmen.
- Auch das Verhältnis zur Europäischen Union bedarf einer Entkrampfung. Einige Reformen zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den europäischen Institutionen wurden bereits eingeleitet. Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen wünsche ich mir, dass Ihr erster Aufenthalt außerhalb Österreichs, dem Europäischen Parlament gilt. Auch als Zeichen dafür, dass Europapolitik Innenpolitik ist.
- Schließlich geht es um die Medienlandschaft in Österreich. Unabhängiger Journalismus ist die Basis jeder Demokratie. Gegen dieses Prinzip wurde in den letzten Jahren oft verstoßen.
Ich weiß, dass ein Bundespräsident kraft seiner Befugnisse die wenigsten dieser Forderungen unmittelbar erfüllen kann. Aber wer, wenn nicht Sie, kann den initialen Anstoß dazu geben. Ich wünsche mir, dass Sie die symbolische Autorität Ihres Amtes und Ihre moralische Integrität dafür einsetzen, dass wir endlich den lähmenden Stillstand in unserem Land überwinden können. Gelingt das nicht, dann wird all das eintreten, wovor sich die Menschen in diesem Land ängstigen. Das ist der Grund, weshalb ich Sie mit voller Überzeugung unterstütze und alle meine Freundinnen und Freunde ersuche, es mir gleich zu tun.
Mit den besten Wünschen für nächsten Sonntag
Ihr
Josef Weidenholzer